Hier gibt es einen Rückblick auf die 26 Ausgaben meines Romantick Podcasts! Veröffentlicht wurden diese auf sämtlichen Podcast-Plattformen zwischen 20. September 2022 und 9. Mai 2023. Viel Vergnügen beim Lesen und Hören!
Nichts ist für immer - alles wird vergehen
Ich melde mich zurück aus dem Kurzurlaub in Mojacar, Andalusien. Gemeinsam mit Athena nach zwanzig Jahren Lebenspartnerschaft und im kommenden November bereits 15 Jahren Ehe, erstmals fünf Tage ohne unsere drei Söhne. Herrlich, aber auch irgendwie seltsam, leer, auffällig ruhig. Für fünf Tage gemeinsam einsam sein, unerprobt, die Spanische Sonne im Gesicht, das glasklare Wasser hinterlässt Salzspuren auf der Haut, gutes bis grandioses Essen, viel Frischluft und herrlicher Fahrtwind. Ewig wirkende Andalusische Landschaften - viel Raum zum Atmen, viele Erinnerungen und Emotionen. Schon sehr viel dort erlebt. Zeit zum Innehalten, Nachdenken und Gedanken wieder abgeben. Barfuß durchs Meer stapfend, eine Stunde lang kindisch verspielt mit den hohen Wellen badend und schwimmend. Ja, es war herrlich und wir kommen bald wieder. Versprochen.
„Nichts ist für immer - alles wird vergehen“ ist also der Titel meiner heutigen Geschichte. Ein Satz, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Ob ich ihn so selbst mal in eines meiner Notizbücher schrieb oder irgendwo zwischen Wien, Los Angeles, Mojacar oder Aschach an der Donau mal auffasste, kann ich heute nicht mehr genau sagen. Ist ja auch egal - es geht um den Inhalt. Jedes Mal wieder aufs Neue hat dieser Satz, ja haben diese klaren, weisen, sinnbringenden und bereichernden Worte zuerst eine etwas pessimistische Wirkung auf mich. Wenn man aber genau hinsieht beziehungsweise hinfühlt, kann man schnell erkennen, welch positive Kraft in diesem Wortgefüge steckt. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit und der Endlichkeit des hiesigen Daseins führt bei mir immer wieder zu großer Dankbarkeit für alles bisher Geschehene und das Jetzt. Siehe hierzu auch mein Song „You Have Come So Far“ von meinem „MA’AN“ Album aus dem Jahr 2015 (hierzu auch Ausgabe 17 meines Podcasts mit dem Titel „Die Lebenspyramide“).
Ich begebe mich tagtäglich auf die Suche nach freudvollen Momenten und Augenblicken und bin mir der Vergänglichkeit dieser stets bewusst. Dies hilft mir immens dabei, diese Momente pur und essentiell zu erleben. Wenn ich als Mensch schon Jäger und Sammler bin, dann am liebsten so. Da fällt mir gerade ein, dass ich euch noch etwas passend zum Thema „Bleib in deiner Liebe“ der letzten Ausgabe vom 25. April erzählen wollte. Da ging es ja um den lebensnotwendigen Selbstschutz gegen die täglichen Bedrohungen und Lärm-Trigger von außen. Als Fazit und Selbsterkenntnis schrieb ich unter anderem den Satz, „Ja, im Kultivieren und Warten meiner persönlichen Firewall habe ich offensichtlich noch viel Luft nach oben.“ Nun gut, ich bin dran, tagtäglich am Ende des Tages nach dem Hinausgehen in die Welt wieder in mich zurückzukehren. Als wir letzten Donnerstag wieder aus Andalusien zurückkehrten hatte Facebook eine schöne Nachricht für mich. Am letzten Tag in Spanien wurde ich von Facebook informiert, dass sich in offenbar Vietnam irgendjemand bei meinem Axel Wolph Account anmelden wollte und wurde aufgefordert einen sechsstelligen Verifizierungscode einzugeben. Auf meinem iPhone funktionierte meine Facebook-Seite aber ohne Probleme und es kam auch keine Maske zum Eingeben des Sicherheitscodes. Einen Tag später, hier im Studio, musste ich feststellen, dass ich von Facebook gesperrt wurde - alle meine Emailadressen und meine Telefonnummer waren nicht mehr bekannt, kein Login auch nur irgendwie möglich. Juhu, ich wurde offensichtlich gehackt und gesperrt. Ob auf Lebzeiten oder nicht, kann ich heute noch nicht sagen. Einen Tag später jedenfalls bekam ich die Nachricht dass die Hacker mit meinem Facebook Business Account neue Werbeanzeigen geschalten haben und diese bereits aktiv seien. Hallelujah, was für ein Wahnsinn! Ich rief sofort bei meiner Bank an und ließ meine VISA Karte sperren. Traumhaft ist auch, dass dieser riesige Konzern de facto keine direkte Kundenbetreuung mehr anbietet. Der Facebook Gott sitzt auf seinem Zuckerberg und lässt es sich gut gehen - Hacker hin oder her. Prost.
Ich war zuerst sehr wütend und tobte im Studio vor Ärger über diesen Wahnsinn, ja diesen Trigger von außen. Gerade noch entspannt oder fast wieder fit (ich hatte in Spanien leider mit enormen Halsschmerzen zu kämpfen, was auch dazu führte, dass ich der 50er Feier eines Freundes vor Ort nicht beiwohnen und ihm auch kein erwünschtes Ständchen an der Gitarre singen konnte - ich kann und mag leider auch nicht immer und jederzeit in die Manege hüpfen, bin auch nur ein Mensch mit manchmal Halsschmerzen, schlecht bei Stimme und unfit…) daheim angekommen und sofort so ein unterm Strich unnötiger Müll und Stress. Mittlerweile find ich es sogar angenehm, so ganz ohne dem Gesichtsbuch. „Facebook ist eh passé…“ sagen meine Teenagersöhne Matti und Laurin zutreffend. Ich bin ja auf Instagram, Twitter und WhatsApp eh noch sozialmedial erreich- und sichtbar. Wer mich also auf Facebook vermisst, nicht wundern - now you know why. Ich arbeite an meiner Firewall weiter, dies hab ich mir selbst im Zuge meiner voraussichtlichen Facebook-Befreiung versprochen. Und auch diese Problemchen halten nicht für immer und werden vergehen. Somit weiter im Text von heute.
Ein Stille-Lehrer von mir in Wien hat mich mal nach einer intensiven Stille-Sitzung gefragt, was denn das Schönste an Gefühlen und Gedanken sei. Ich schüttelte zuerst unwissend den Kopf, kam zu keiner klaren, gültigen Antwort. Daraufhin meinte er: „Das Schönste an Gefühlen und Gedanken ist, dass sie vorrübergehen, ja vergänglich sind. Und zwar alle, die schlechten sowie die guten.“
Wow, diese Erkenntnis löste eine große innere Freiheit in mir aus. Zu sehen, dass ich zwar Denken kann und sogar sehr viel, so wie ich mich kenne, ich aber nicht mein Denken bin, hat mein Leben sehr verändert. Déscartes meinte vor vielen Jahren noch „Cogito ergo sum“, „Ich denke, also bin ich“. Ich sage gerne „Sentire ergo sum“, „Ich fühle, also bin ich“. Noch besser „Ich nehme wahr, also bin ich“. Ich hatte nie Latein in der Schule und man möge mir etwaige Unkenntnisse verzeihen.
Bei meiner heutigen Rennradrunde in der Morgensonne kam mir dieser schöne Satz wieder in Erinnerung und sogleich eine Songidee aus dem Jahr 2017 in den Sinn. Ein Songmemo an der Akustikgitarre wo ich spontan die folgenden Worte sang:
Nothing is forever, my son
Pick a flower, soon withered and gone
Believe me, your life has just begun
Nothing is for granted, my son
Your feed of joy can one day be gone
Believe me, your life has just begun
Und so weiter und so fort.
Leider hab ich den Song bis heute nicht finalisiert, kann aber bald mal der Fall sein. Im Zuge meiner Aufnahmesessions und Arbeit am „MA’AN“ Album, habe ich folgenden Song mit dem Titel „Feather“ geschrieben und auch in Alleinregie und an allen Instrumenten hier im damals noch ganz neuen Green Meadow Studio in unsrem Landhaus aus 1757 eingespielt, produziert und gemischt. Nach meiner heutigen Morgenstille-Sitzung kam mir zum Thema von heute auch dieses Lied aus meiner Feder in Erinnerung. Ich habe auch bis heute keine Ahnung, weshalb dieser Song nicht mit aufs Album kam - er hätte perfekt dazu gepasst und hat mich heute, als ich ihn endlich auf irgendeiner meiner vielen Backup-Festplatten in einem verstaubten Order wiederfand zutiefst bewegt und echt erwischt. Wow, dachte ich, was für ein Rohdiamant. Ich möchte ihn nun hier zur Gänze und in voller Länge mit euch gemeinsam teilen und genießen und sag nur: „Life is like a feather, slowly drifting through space and time.“ Viel Vergnügen.
Oh ja…Und auch auf meinem ROMANTICK Album vom letzten Jahr bin ich zu diesem Thema spontan fündig geworden. Die Musik klingt ähnlich, mein persönlicher Sound sozusagen, diesmal halt in meiner Muttersprache meiner verstorbenen Mum zuliebe. Der Song trägt den Titel „Wie es war“ - hier ein kurzer Auszug davon - in voller Länge überall wo es Musik gibt. Auch hier singe ich sinngemäß Zeilen wie:
Heute bleibt für immer, niemals so wie es war
Bleibt doch alles vergänglich
Kommt doch alles so wie es war
Oder:
Nichts hält für immer
Alles nur im Augenblick
Jeder kennt die Wege
Doch niemand will sie gehn
Auch wenn man dies aus marketingtechnischen Gründen als Künstler niemals sagen darf - ich glaube, dies ist mein persönlicher Lieblingssong auf meinem ROMANTICK Album.
Gerne sage ich zu Freunden an Geburtstagen die Worte „Bleib so, wie du noch nie gewesen bist!“. Und ich glaube, dies möchte ich euch auch heute hier und jetzt für die kommenden Tage mitgeben: Nichts ist für immer - alles wird vergehen. Jedes Mal, wenn ihr euch nicht gut fühlt oder mit Gedanken überflutet seid, denkt an die Vergänglichkeit. Mir hilft es auch immer wieder, akute Gedanken und Gefühle in meinen Notizbüchern zu notieren und mir zwei Wochen später nochmals anzusehen. Meistens kann ich es gar nicht fassen, dass ich diese Worte verfasst habe.
In diesem Sinne gilt es weiterhin und für noch viel länger, die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Ab nächster Woche erscheinen meine neuen Ausgaben jeweils donnerstags. Bis bald, euer Axel, Byebye
Bleib in deiner Liebe
Podcast Ausgabe 25 am 25., schön. Also normalerweise setze ich mich hier in meinem Studio zum Schreibtisch, starte eine frische, neue Seite in Apple Pages und schreibe frei drauf los. Frei nach dem irgendwann und irgendwo in Kalifornien mal aufgeschnappten Motto „start your day like a white canvas“. Heute scheint dies nicht wirklich so leicht wie üblich zu funktionieren. Und ich bemerke, wie mein Kopf voll und laut ist und dies obwohl ich mir heute Früh schon eine kurze Morgenmeditation gönnte. Der Lärm von außen ist derzeit einfach täglich sehr laut und verhallt nur langsam in mir.
Gerade kam unser letzter Volksschüler und Beatles-Pianist Nielsi von der Schule nach Hause. Nach nem ersten Dreier auf die letzte Mathe-Schularbeit nun auch auf die Deutsch-Schularbeit nur ein „Befriedigend“. Abermals Tränen und große Enttäuschung inklusive. Vor ein paar Wochen noch als Bester seiner Klasse Vertreter seiner Schule bei der Lese-Olympiade - nun diese Enttäuschungen. Er schreibt nicht schön genug und neigt zu Schlampigkeitsfehlern. Okay, wir nehmen es zur Kenntnis. In vier Volksschuljahren drei unterschiedliche Lehrerinnen. Ich kann dazu eigentlich nichts mehr sagen und werde somit heute nicht weiter über das leidige, ja unerträgliche Schulsystemthema sinnieren - dies interessiert euch wahrscheinlich nicht und mir fehlen mittlerweile nach bald 12 Volksschuljahren als Vater die Worte. Wichtig ist nur immer und an ganz vorderster Stelle: Permanente Beurteilung von außen und beinahe täglich der schulische Fingerzeig: Eure Buben sind als Schüler nicht gut genug und ihr seid als Familie nicht gut genug für Vorzugsschüler. Herrlich, her damit, ich liebe es! NOT. Ich war einst ein Vorzugsschüler - gejuckt hat dies zeitlebens niemanden.
Aber ist es derzeit nicht generell so? Also mir kommt es mittlerweile so vor, als hätte man mich vor ein paar Jahren ins Koma gerissen und vor kurzem wieder ins Leben zurück geschmissen. Zum Glück ist dem de facto nicht so, aber in meinem Sein als Vater, Mensch und Künstler klafft derzeit immer wieder ein riesiges Loch. Letzte Woche sprach ich vom Teilchenbeschleuniger Alltag und stellte die Frage wonach du brennst. Und natürlich richtete ich diese Frage als Urheber des Textes natürlich auch an mich und sinnierte über dies und das und kam zur Einsicht, dass ich mir in den letzten Jahren selbst nicht immer treu geblieben bin. Ich habe mich verbiegen lassen und mich selbst verbogen. Aber dazu vielleicht später noch mehr.
Themenwechsel: Ich finde es witzig, dass sich Bären und Wölfe ihre alte Welt wieder zurückholen. Zuerst wollte der Mensch sie ausrotten und schlicht weg haben, dann haben andere Menschen die letzten ihrer Gattung gerettet, gezüchtet und wieder ausgesetzt und jetzt wundern wir uns, wenn sie sich zurückerkämpfen, was einst ihnen gehörte. Gestern laß ich auf geo.de einen Bericht darüber, wie man sich idealerweise verhalten sollte, wenn man in freier Natur einem Bären begegnet. Kurz wie üblich als Anfangswissenfrage formuliert: Wusstest du, wie man sich richtig verhält, wenn man im Wald einem Bären begegnet? Ich nicht und ich machte mir bisher auch noch nie wirklich Gedanken darüber. Und ich bin eigentlich oft im Wald. Kurz zusammengefasst: Man sollte ruhig bleiben, den Bären nicht anschreien oder gar mit Stöcken vertreiben. Man sollte sich ruhig und stets den Bären im Blickfeld behaltend, langsam und behutsam aus dem Staub machen. Sollte der Bär einen schon angegriffen haben und man noch leben, dann wird empfohlen, sich flach und ruhig auf den Boden zu legen und die Hände im Nacken zu verschränken. Okay, so viel zur Theorie, die sich logisch liest, aber irgendwie kaum einen Realitätsbezug hat. Aber klar, wir sollen immer alle ruhig bleiben, wenn man von außen bedroht wird. Schräg finde ich nur, dass ich vor ein paar Tagen zufällig ein YouTube Video von einem mir unbekannten Mann sah, worin dieser einen Bärenangriff beim Wandern mit seiner GoPro Kamera mitfilmte. Er tat genau das Gegenteil von den Empfehlungen der Experten: Er brüllte den Bären wie ein Irrer an, so laut er nur konnte und schlug das Raubtier mit Steinen und Stöcken in die Flucht. Ein harter, minutenlanger, atemberaubender Kampf mit Sieger Mensch.
Tja, und wem soll man nun glauben? Einen Tipp von den Experten fand ich auch noch eher skurril als methodisch anwendbar: Man sollte bei Wanderungen in potentiellen Bärenregionen stets singen und sich nicht zu laut aber gut hörbar unterhalten - so sei die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich ein Bär rechtzeitig vor uns Menschen zurückzieht. Wenn du also bei deiner nächsten Waldwanderung im Bärengebiet laut singende Wandersmänner und -frauen hörst, dann weißt du, sie haben entweder ein Geo-Abo oder sie hören meinen Podcast.
Was mir an der von den Expertinnen empfohlenen Abwehrhaltung gegen Bären aber grundsätzlich irgendwie gefällt ist die Vorgabe und Idee, stets Ruhe zu bewahren. Und so kann ich aus der Bärengeschichte gleich direttissima zum Titel und Thema meines heutigen Kurzreferates schwenken: Bleib in deiner Liebe.
Klingt pathetisch, ich weiß, aber seitdem ich diese paar Worte vor einigen Jahren mal in eines meiner vielen Notizbücher schrieb, musste ich schon unzählige Male erkennen, wie schwer es ist, diesem liebevoll gemeinten Imperativ Folge zu leisten. Dafür aber umso schöner, wenn es einem gelingt. Ja, an dieser emotionalen Erhabenheit, sprich Bewahrung meiner Würde arbeite ich Tag ein, Tag aus. Nahezu tagtäglich gibt es externe Trigger, ja blitzartige Auslöser, plötzlich bedrohliche, ärgerliche bishin zu verletztende Situationen und Umstände sowie fragwürdige Aktionen von toxischen Personen, die einen schlagartig aus der eigenen Mitte bringen können. Und obwohl ich in 44 Lebensjahren natürlich gelernt habe, mit den täglichen Herausforderungen umzugehen, so kommt es mir in Zeiten wie diesen oder sagen wir in den letzten paar Jahren so vor, als hätte die Dichte und Quantität der externen Angst- und Panikmacher, Troublemaker und Funkiller horrend zugenommen. Da wir sie ohnedies alle kennen, möchte ich sie hier jetzt auch nicht extra alle aufzählen, schade, um die wertvolle Zeit. Jeder kennt sie und jeder hat auch seine eigenen, ganz persönlichen Angst- und Panikgeneratoren.
Am besten hilft mir persönlich immer wieder entweder eine lange Stille-Sitzung, also wach sein ohne zu denken, Musik machen, eine Gehmeditation, eine schöne, lange Motorradrunde oder ein Zehnkilometerlauf entlang der Donau, um nur ein paar zu nennen. Ja, entlang der wunderbaren Donau, meinem Lebensfluss, wenn man so will, habe ich in den letzten Jahren einige schöne Kraftorte gesammelt. Und deshalb habe ich ihr vor ein paar Jahren bereits ein Klavierstück gewidmet. Hier und heute in ganzer Länge, gespielt auf meinem alten, moderaten Lauberger und Gloss Konzertpiano, am Cello mein guter Freund und langjähriger, musikalischer Weggefährte Florian Eggner. Viel Vergnügen nun mit „Donau“.
Ja, auch die Musik kann die Zeit immer wieder kurz still stehen lassen. Es geht mir demnach heute nicht darum, die exteren Trigger zu vermeiden, sondern vielmehr darum, sie gekonnt und emotional erhaben zu dulden. Anders gesagt: Es bleibt ein tägliches Hinausgehen in die Welt, aber man sollte auch täglich wieder in sich nach Hause kommen. Mir geht vieles nach wie vor und immer wieder viel zu schnell ans Herz - ja, im Kultivieren und Warten meiner persönlichen Firewall habe ich offensichtlich noch viel Luft nach oben. Dass ich hier ganz offen darüber schreibe und spreche, ist meinem Selbstschutz per se auch nicht gerade dienlich, ich weiß. Egal, ich mache es trotzdem. Auch deshalb, weil ich dieses, der Mentalität meiner Heimat so nahes, ewige Schweigen nicht ausstehen kann. Ich denke mir, wenn ich schon den Mund aufmache oder Buchstaben in meine Tastatur drücke, dann wenigstens mit einem hohen Ausmaß an emotionalem Wahrheitsgehalt.
Und somit bleiben folgende Fragen aus meinem heutigen Text für dich und euch da draußen übrig: Wie würdest du dich verhalten, wenn du einem Bär im Wald begegnest? Würdest du dich passiv auf den Boden legen und still und ruhig hoffen, dass er weiterzieht und sich lieber ein Reh zum Mittagessen holt oder wie der angegriffene Mann im YouTube-Video laut um dich brüllen und mit Händen und Füßen um dein Leben kämpfen? Was hilft dir im Umgang mit den alltäglichen Herausforderungen? Wie schaffst du es, in deiner Liebe zu bleiben?
So, nun habe ich doch noch ein paar bunte Buchstaben auf meine weiße Leinwand von heute getippt. Ich denke, es geht genau darum, tagtäglich, trotz aller externer Faktoren sich immer wieder selbst im Inneren liebevoll zu begegnen. Nur in einem selbst liegt die Basis für den größten Widerstand gegen Dies und Das. Man hat nur dieses eine Leben im Hier und Jetzt und ich vermute, es gilt genau deswegen die rare Zeit zu nützen.
Wofür brennst du?
Wow, schon wieder ist eine Woche vergangen seit meiner Geschichte vom Männlein aus dem Walde. Meine gewollt offenherzige Reflektion über das Mannsein als moderner Mimosenmann hat offenbar einige von euch bewegt und zum Nachdenken und Reagieren gebracht. Danke fürs feine Feedback mal zwischendurch.
Kommt es nur mir so vor oder hat jemand generell die Zeit beschleunigt? Ja, der Teilchenbeschleuniger Alltag gibt grad mal wieder ordentlich Stoff. Oder hatte ich in den letzten Tagen nur zu wenige Stille-Sitzungen, um mich und mein Denken wieder einzubremsen, ja einzufangen? Kurz anders gefragt: Ist heute eine Minute noch so lange wie vor 30 Jahren? Oder wie vor 2500 Jahren? Keine Ahnung, aber ich vermute, dass die Zeit an sich genauso wie das Geld in Zeiten wie diesen eine immense Inflation erfährt. Vermutungen sind aber natürlich keine Behauptungen und schon gar kein Wissen, ich weiß.
Zeitlebens möchte ich mit meiner Musik und meinen Texten, ja mit meiner Kunst, auch dem Entschleunigen meinen Dienst erweisen. Genau dies mag ich auch an meinem ROMANTICK Podcast: Im Sinne der Worte „Disziplin in die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen“ (siehe dazu meine Geschichte vom 18. Oktober 2022, also Ausgabe 4 meines Podcasts) meines einstigen spirituellen Lehrers in Wien, möchte ich mich einmal in der Woche hier im Studio hinsetzen und über Gefühle, Gedanken und Geschichten aus meinem Leben schreiben und dir und euch damit ebenfalls eine kleine meist ca. fünfzehn-minütige Auszeit vom Alltag geben. Das Schreiben meines wöchentliches Aufsatzes ist oft zeitlich tatsächlich nicht einfach unterzubringen und so dachte ich letztes Wochenende tatsächlich an ein baldiges Ende meines Podcasts - wenn ich mich dann jedoch wieder hinsetze und schreibe bemerke ich, dass ich einfach sehr gerne schreibe, ja dafür brenne, aus dem Nichts etwas Neues, ja Erlebbares zu kreieren. Und wofür man im Leben brennt sollte man zeitlebens ganz bewusst leben und kultivieren. Darum solls heute gehen in meinem Kurzreferat.
Vor wenigen Augenblicken kam mich mein jüngster Wolphswelpe Niels spontan im Studio besuchen, begleitet von den Worten „Ich möcht dich nur kurz besuchen und dir was am Klavier vorspielen.“ Eines vorweg, Niels ist wie ich und mein Vater bereits jetzt ein großer Beatles-Fan und hört gerne zum Einschlafen deren wunderbare Musik am Kopfhörer auf Spotify. Ich bin zwar kein großer Fan des ganzen Streaming-Themas (hauptsächlich wegen des katastrophalen Entgelts für Urheber wie mich) , aber in Fällen wie diesen finde ich es schon grandios, dass die Nachkommenschaft die Möglichkeit hat, die fast gesamte Musikgeschichte auf einem knapp einen Zentimeter hohen Computer, ja iPad überall und immer zur Verfügung zu haben. Was hab ich damals noch CDs und Schallplatten geschleppt bei einer Wohnungsübersiedlung. Ja, der technische Fortschritt hat de facto auch sehr gute Seiten an sich. Viele sogar - oftmals werden leider auch berechtigt nur die negativen Auswirkungen beleuchtet. Alles hat seine Berechtigung, klar. Wie immer gilt es auch hier den mittleren Weg zu finden. Es wäre interessant zu wissen, ob ein Siddharta Gautama oder Jesus von Nazareth heute auch auf Instagram, Facebook, Twitter oder TikTok wären. Ich vermute ja, und sie würden ihre Messages und Lehren als Wanderprediger wohl in ihren Status stellen. Der Punkt ist nur, sie würden von den Algorithmen wahrscheinlich nicht geteilt werden. Who knows. Egal, weiter im Text.
Niels spielt seit geraumer Zeit Klavier und lernt, nicht wie ich damals in seinem Alter Beethoven und so Zeugs, also Klassik, sondern Rock, Pop, Jazz Songs. Seit Wochen spielt er täglich mehrmals „Let it Be“ von Paul McCartney auf seinem eigenen ca. hundert Jahre alten Lauberger & Gloss Konzertpiano, Modell „Strauss“, in unserem Esszimmer. Und obwohl generell ein fast schon totgespieltes Stück Musikgeschichte, so berührt es mich doch immer wieder aufs Neue - gerade aus seinen Fingern. So simple, so am Punkt. Vorhin, also vor mittlerweile gut einer Stunde, kam er zu mir um mir kurz „Imagine“ vorzuspielen. Jenes Lied, welches natürlich ebenso schon fast totgespielt ist, mich aber ungefähr in seinem Alter, ich denke, ich war sogar noch zwei, drei Jahre jünger damals, erstmals musikalisch zu Tränen rührte. Und dies, obwohl ich damals ja kaum ein Wort des Textes verstand. Es war einfach so unglaublich schön, dass ich nach dem ersten Hören am Plattenspieler meines Vaters beim Ausklang der letzten Akkorde schon mit mir bisher noch unbekannten Tränen der Rührung da saß und sofort wieder die Nadel in die erste Rille dieses Meisterstückes legte. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals dieses grandiose Lied wochenlang immer und immer wieder hörte.
Ohne Zweifel löste dieses Musikstück einiges in mir aus und vermag dies auch heute noch zu schaffen. Im richtigen Moment ist „Imagine“ immer noch killer. Da fällt mir gerade eine Situation im Studio gemeinsam mit meinem Musikus Sohnemann Laurin vor ein paar Wochen ein. Ich stolperte auf Spotify über eine Piano only Interpretation von „Imagine“ von einem Künstler, der mir jetzt gerade partout nicht mehr einfallen möchte (ich glaube, ich wusste seinen Namen auch noch nie wirklich, ich hab einfach wo drauf geklickt, wo „Imagine“ geschrieben stand…naja, er möge es mir verzeihen…) Laurin hatte gerade eine unserer Gitarren in der Hand und nudelte (so nennt man es, wenn man frei drauf los soliert ohne Netz und doppeltem Boden sozusagen…) spontan ein bissl dazu. Nur ganz wenige Töne, und manche auch falsch, aber dennoch hört man sein Talent. Auch diese kleine zufällige Sprachmemo berührt mich. Sein Gefühl für Musik ist grandios und dies freut mich als sein Papa schon sehr. Ja, Auch Vaterstolz darf kurz mal sein.
Anyways, „Imagine“ zeigte mir damals meine innere Leidenschaft für diese wunderbare, riesige Welt der Musik erstmals auf. Ich hörte die Schallplatten meines Vaters und auch meiner zehn Jahre älteren Schwester gefühlt tausendfach von vorne bis hinten, von oben bis unten und immer wieder aufs Neue. Kein Spotify und Überangebot. Wenige, vielleicht ein paar Dutzend waren es - aber immer und immer wieder. Dire Straits „Brothers in Arms“ zum Beispiel oder „Tug of War“ von Paul McCartney, The Beatles „Live at the Hollywood Bowl, to name only a few. Wenig später, als die CD auf den Markt kam und meine Regale im Jugendzimmer voll waren damit, blieb das Prinzip gleich. Wunderschön. Alleine das Gefühl, eine Schallplatte oder eine CD samt Artwork in den Händen zu halten war schon etwas ganz Besonderes und hatte es mir ohne Zweifel und ganz tief drinnen in mir angetan. Am besten noch das Booklet in den Händen und frei drauf los mitsingend. Grandios. Deshalb gibt es mein ROMANTICK Album ja auch als limitierte Vinyl-Auflage und als Doppel CD Digipak inklusive meiner Muttersprache EP Deluxe. Mehr dazu findet ihr gleich auf der Startseite meiner Website www.axelwolph.com
Imagine von Niels heute kann ich euch nicht vorspielen und würde euch wahrscheinlich keineswegs so berühren wie mich - aber gebt euch selbst mal wieder die Chance, ja den Moment, dieses Lied in Ruhe und auf Kopfhörern zu erleben. Da bleibt die liebe, ja so rasend erscheinende Zeit dann mal wieder kurz stehen.
Und somit komme ich meiner Idee für meinen Aufsatz von heute allmählich einen Schritt näher: Nielsi zeigte mir heute am Tennisplatz am Nachmittag und eben vorhin gerade mit seiner noch etwas holprigen, ersten Darbietung von „Imagine“ vor allem eines: Wir alle sollten für etwas brennen. Oder anders gesagt: Wir alle brennen für etwas. Wofür brennst du?
Meine Eltern gaben mir die Chance, dieses Brennen für etwas kennen zu lernen. Dafür bin ich ihnen ewig dankbar und ich denke, genau darum geht es, wenn man neues Leben in die Zeitrechnung setzt. Mein erstes Brennen galt damals als kleiner Bub dem Tennis. Obwohl ich für vieles brannte, wollte ich unbedingt Tennisprofi werden und spielte das Garagentor, diverse Autospiegel und Fenster kaputt. Ich spielte auch im Winter in einem eiskalten, unbeheizten Nebenraum unsres Hauses Schattentennis und gewann so sogar mehrmals Wimbledon. Mit grandiosen Schlägen, die niemals welche waren oder gar jemand sehen konnte. Gefühlt war es großartig und niemals zu vergessen, ja emotional bis heute abrufbar.
Und wenn ich mir diese Welt, nun als 44 Jähriger immer wieder mal anschaue, so komme ich zum Schluss, dass das „Für-etwas-Brennen“ unser aller Lebenselexir ist. Klar, so unfassbar viele Menschen bekommen zeitlebens niemals die Chance auch nur ansatzweise für ihre Leidenschaften zu brennen - zu viel Leid und Wahnsinn überall. Ja, der weltweite Existenzkampf hält uns alle davon ab. Aber darüber kann und will ich heute nicht schreiben, weil ich es a) jetzt in diesem Moment nicht ändern kann und b) so ein wöchentlicher Aufsatz nicht das Medium dafür ist. Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal am Ende meines Lebens das Gesamtwerk meines Schaffens, mein so genanntes Lebenswerk: Die vielen Songs und Texte, Musikstücke aus meiner Feder, mein Vater- und Lebenspartnersein, mein Freundsein, meine Tennisstunden als Tennisliebender, oder gar diese spontanen Texte, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit j auch mal in Buchform geben wird. Who knows…
Ja, vielleicht kann mein Lebenswerk irgendwann mal auch viele Menschen bewegen. Es mag ein naiver Traum sein, doch ohne zu träumen ist ein Leben wohl nicht lebenswert, siehe: „Imagine“! Und um die Reichweite oder wie man heutzutage sagt das Following geht es bekanntlich wahrlich nicht primär. Oder wie ich gerne viel schlichter sage: Jeder Mensch möchte zeitlebens gesehen werden und im besten Falle geliebt. Beides ist mir schon jetzt gelungen und dies stimmt mich heute schon zufrieden.
Ja, ich werde bereits geliebt, von ein paar Menschen. Ist diese Erkenntnis nicht wunderschön? Von wem wirst du bereits jetzt und in diesem Moment gesehen und geliebt? Es geht nicht um die so genannte Selbstverwirklichung und drei Milliarden Clicks auf Instagram auf ein halbnacktes Photo von deinem Hinterteil oder so. Es geht darum, jener Mensch zu sein, der man ohne vieler Gedanken im Kopf per se jetzt schon ist. Und immer wieder auch das zu tun, wofür man brennt. Und genau deshalb mag ich ja den Begriff „Leidenschaft“ nicht: Zu tun, wofür das Innerste, ja dein oder mein Innerstes brennt, schafft kein Leiden. Ganz im Gegenteil! Es schafft Lebensfreude, ja pure, neue Lebensenergie und diese brauchen wir alle, gerade in Zeiten wie diesen, um die so genannte Zeit wieder zu entschleunigen.
Eckhart Tolle, zum Beispiel, spricht immer wieder davon, dass es gar keine Zeit an sich gibt, sondern nur das Jetzt - die Zeit, er nennt sie „psychological time“ ist ein gedankliches Konzept, welches zwar organisatorisch Sinn macht, aber dem Leben im Moment nicht dienlich ist. Ja, dem kann ich schon was abgewinnen. Für viele da draußen abstrakt, ich weiß, genauso wie die Tatsache, dass es auch keine Jahreszahlen gibt. Für Christen ist gerade 2023. Für Buddhisten ist gerade 2566. Tja, eben alles nur Zeitrechnungskonzepte die der zeitlichen Orientierung und Navigation durch die Ewigkeit dienen. Wenn ich zu jemanden spontan sage, heute ist nicht der 18. April 2023, sondern nur ein neuer Tag, werde ich meistens nur so angesehen, als hätte ich einen verrückten Frosch verschluckt und dieser hätte gerade kurz in meinem Hals gequakt. Es ist aber ein Faktum. Om, amen, fidibum.
Ich möchte euch heute, passend zu meinem abermals sehr spontanen Kurzreferat, noch meinen Song „Sneakers“ von meinem „MA’AN“ Album aus dem Jahr 2015 ans Herz legen. 2014 schrieb ich folgende Worte in eines meiner Notizbücher:
When your nights are long
And your lights are turned down
When you are trying to breathe
Under your waterfall and drown
When you blame the world
For the pain and grief around
When you stop to believe
In the things you still haven’t found
I say
Move on, move on, move on
When your nights are long
And your moon replaces your sun
When your dreams have gone
For a nightwalk with another one
When you are trying to run
With your worn-out sneakers on
It’s your time to believe
In the things you still haven’t found
I say
Move on, move on, move on
In diesem Sinne gilt es die Zeit zu nützen, denn sie ist offensichtlich gar nicht da. Move on, sehe und erkenne wofür du brennst! Bis nächste Woche, dein, ja euer Axel
Eine Geschichte vom Männlein aus dem Walde
Heute beginne ich meinen wöchentlichen Aufsatz mit einer guten Nachricht: Gerade bin ich von einer zweistündigen Gehmeditation durch das sogenannte „Lange Holz“, einem wunderschönen Waldstück, nicht weit von unsrem Haus entfernt, zurück gekommen und genau beim Betreten der Dusche danach kam mir die zündende Idee, wie ich meine heutige Geschichte beginnen möchte. Vor der angekündigten guten Nachricht zuerst mal wieder mit einer kleinen Wissensfrage: Wusstest du, dass die Natur, ja unsere Fügung als Menschheit genau dafür sorgt, dass wir Menschen stets aus 50% Mädels und 50% Buben bestehen? Schon imposant, finde ich. Wenn man es jedoch etwas genauer betrachtet, dann ist das nicht ganz so. Also nicht ganz genau 50:50. Vor ein paar Tagen hab ich gelesen, dass eine neue Studie zeigt, dass (China und Länder, die sich im Krieg befinden mal ausgenommen) auf 100 Mädels 105 Buben zur Welt kommen. Als ich 1998 maturierte lernten wir im Geographie und Wirtschaftskundeunterricht noch ein Geburten-Geschlechter-Verhältnis von 100 Mädels zu 108 Bubis. Und dies ist die gute Nachricht für mich: die Anzahl von geborenen Männern sinkt. Sorry Boys - ich meine damit natürlich nicht meine drei Welpen und Schätze Laurin, Matti und Niels. Eher generell gesehen - als Großes Ganzes. Und wenn man die Geschichte der Menschheit sowie leider auch das aktuelle Weltgeschehen nur ein bissl genauer betrachtet, wird man keinen Doktortitel in Politik oder Geschichte brauchen, um erkennen zu können, dass die meisten, wenn nicht eindeutig alle Katastrophen und Kriege nicht wirklich von Frauen losgetreten werden. Ja, klar, ohne Testosteron wären wir alle nicht hier, gäbe es offenkundig generell keine Fortpflanzung, aber zu viel davon (oder zu wenig, wer weiß…) macht aus Buben oftmals ekelhafte, widerliche, fürchterlich aufgeblasene Tyrannen und Vollidioten. Wenn ich derzeit den russischen Gockel nur drei Sekunden lang im TV sehen muss, kommt mir jedes Mal das mit Liebe gekochte letzte Mahl wieder hoch.
Ach Gott, ich geniere mich schon mein ganzes Leben lang immer wieder dafür, ein Mann zu sein. Klar, es gibt natürlich auch andere Männer. Eine Grauzone zwischen Macho, Tyrann, Vollidiot und Weichei, Mimose, Memme gibt es aber anscheinend immer noch nicht wirklich. Zeigt und lebt ein Mann auch seine , durch sein x Chromosom vorgegebene 50% weibliche Seite, so wird er schnell von „echten“ Männern als Weichei abgestempelt. Mir als Hypersensibler, Synästhetiker und Mimosenmann, ja alles stereotypisch für einen Künstler, geht diese Geschlechtertrennung innerhalb des Mannseins schon zeitlebens volle Kanne auf den Sack. Klar, ich bin 190cm groß und von Natur aus eher von muskulöser Statur - als Leistungssportler neigte ich optisch zum Beispiel immer schnell zum Popeye, wenn ich zu viel Zeit in der Kraftkammer verbrachte. Deshalb durfte ich damals ja auch von klassisch männlichem Krafttraining mit Gewichten und Hanteln und so Zeugs zu isometrischem Krafttraining und Yoga wechseln. Auch ziemlich mimosisch, jetzt mal so als „echter“ Mann betrachtet. Haha. Egal, weiter im Text.
Ich erinnere mich gerade an eine kleine lustige Geschichte vor einigen Jahren am Weg zum sonntäglichen Morgenlauf. Im hiesigen „Hitradio“ lief zufällig (ich höre selbst quasi nie Radio - schon gar nicht im Auto) eine „Frühstück bei mir“ Sendung mit Udo Jürgens zu Gast. Also nicht Voodoo Jürgens, sondern das Original. Gott, oder wer auch immer, hab ihn selig. In dieser Sendung wetterte der schon leicht senil wirkende Barde damals über den sogenannten modernen Mann aus seiner Sicht eines Machos und Playboys der Siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Der Grundtenor war quasi so: Die Männer von heute sind nur mehr Weicheier, die Verweiblichung des Mannes ist fürchterlich, etc. Schlicht Mumpitz in meinen Ohren. Gegen Ende hin lenkte die Interviewerin das Gespräch geschickt in Richtung Geburt und Männer, also dem Faktum, dass heutige Weicheimänner auch bei Geburten dabei sind im Unterschied zu den Männern seiner Generation. Er meinte, Männer hätten auf einer Geburtsstation nichts verloren und er selber könne sich das aus nervlichen Gründen gar nicht vorstellen, ja er würde sofort in Ohnmacht fallen.
Tja, ich war als moderner Mimosenmann bei allen drei Geburten meiner Söhne dabei und bin nicht umgefallen - ganz und gar nicht. Jede einzelne Geburt war ein atemberaubendes Erlebnis und hat meinen Respekt für die weibliche Kraft und Lebensenergie nur noch weiter verstärkt. Ja, ich out mich hiermit offiziell als Frauenversteher und Fan der weiblichen Natur.
Und ich lege noch ein Schäufchen nach: Ich habe zeitlebens beobachtet, dass die größten Testosteronaffen, ja die aufgeblasensten männlichen Hyperegos unterm Strich die tatsächlich größten Lulus, sprich sinnlosesten und schwächsten Mutanten unserer Spezies auf diesem Planeten sind. Ja, eine Polemik und diese möchte ich weitestgehend ja vermeiden, aber für mich steht eine übertrieben dargestellte, inszenierte und gelebte Männlichkeit immer für eine große und oftmals riesige menschliche Schwäche.
So viel kurz dazu - ich fühle als Mannsbild einfach eine riesige innere Ablehnung gegen dieses althergebrachte Bild vom Mann. Eigentlich genau so wie ich übertriebene Emanzen nicht ausstehen kann. Ob Vater oder Mutter, Mann oder Frau - für mich war und ist dies von Natur aus in der gegenseitigen Ergänzung ein Ganzes und somit nichts als gleichberechtigt und stets von gleichem Wert.
Wie immer liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Extreme führen immer zu Leid und Gewalt. Der von Siddharta Gautama vorgegebene „mittlere Weg“ scheint mir tatsächlich nach wie vor als schönste, sinnbringende weil sofort und fortan anwendbare Lebensphilosophie. Und die Menschheit ist durch u.a. Kooperation, Empathie und Kreativität so weit in der Evolution gekommen - nicht durch Egomanie und Extremismus.
Übrigens, da fällt mir gerade ein: Gerade in letzter Zeit hört und liest man immer wieder das Zitat „Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner geht hin“ von Bertolt Brecht. Klingt beim ersten Blick bzw. Hören schön pazifistisch - aber auch hier bedarf es eines zweiten genaueren Blickes: Das ganze Zitat heißt nämlich: "Stell Dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin - dann kommt der Krieg zu Euch! Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt, und läßt andere kämpfen für seine Sache, der muß sich vorsehen: Denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will, denn er wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.“
Also ziemlich kämpferisch unterm Strich und gar nicht pazifistisch. Nun gut, ich wollts mal nur kurz festgehalten haben. Genauer hinsehen schadet wohl nie.
Schon als kleiner Bub hörte ich oft und immer wieder von meinen Eltern folgenden Satz im Imperativ: „Jetzt schau nicht so hin und nimm nicht immer alle so wörtlich!“ Aber so ist nun mal meine Natur - ich beobachte, nehme wahr und höre genau hin. Hypersensibilität nennt man dies, weiß ich heute. Nicht einfach, aber man lernt damit umzugehen. Meinen Eltern war es oftmals einfach nur unangenehm, wenn ich andere, oft fremde Menschen anstarrte und studierte. Aus Sicht des dreifachen Vaters kann ich dies mittlerweile ganz gut nachvollziehen - lange Zeit dachte ich damals jedoch, dass irgendwas an mir als Mensch nicht in Ordnung sei.
Und noch was Lustiges über mich hab ich heute im Angebot: Schon in der Volksschule machte ich die Erfahrung, dass ich beim Lesen eines Textes mit schwarzen Buchstaben auf weißem Papier viele, viele Farben sehe. Ja, jeder Buchstabe hat für mich eine Farbe und diese können auch wechseln. A ist aber meistens rot, zum Beispiel. Dies lenkte mich beim Lesen schon bald ziemlich ab und lässt mich bis heute sehr schnell ermüden, wenn ich irgendwas lese. Deshalb liebe ich Hörbücher - über die Ohren kann ich Informationen viel länger konsumieren als über die Augen. Ähnlich erging es mir als Kind auch schon im Klavierunterricht: die schwarzen Punkte und Linien, ergo Noten auf weißem Papier ergaben für mich zwar logisch einen Sinn, lenkten mich aber unbeschreiblich vom Klavierspielen ab. Meine Klavierlehrerin Julia Nußbaumer - ich hoffe, sie lebt noch und es geht ihr gut - erkannte dies früh und brachte mir bald neue Stücke nicht mehr anhand von Noten alleine, sondern hauptsächlich durch Vorspielen ihrerseits bei. All die auf diesem Wege, also übers Hören erlernten Stücke, kann ich bis heute spielen. Am liebsten lernte ich so Beethoven Klaviersonaten.
Heute weiß ich: Wenn sich verschiedene Sinneseindrücke zu einer Wahrnehmung vermischen, nennt man dies Synästhesie. Demnach bin ich von Geburt an ein Synästhetiker. Aber keine Angst, ich beiße nicht.
Wenn ich mich zum Klavier setze oder eine Gitarre in die Hand nehme und frei drauf los spiele, begebe ich mich augenblicklich in eine andere Welt. Eine Welt voll unzähliger Emotionen und Farben. Auf Knopfdruck bzw. Tastendruck intensiv und ja, auch anstrengend, fordernd und oftmals auch überfordernd, weil diese innere Welt der vielen Farben, Gefühle und Eindrücke mit der äußeren Welt rund um mich kaum etwas gleich hat.
Der Hinundherwechsel fällt mir oft schwer. Aber auch damit habe ich gelernt umzugehen. Ich liebe die Musik - auch genau deshalb. In der sogenannten Realität, also der äußeren Welt, hatte und habe ich zeitlebens immer wieder mit meiner Hypersensibilität und Synästhesie zu kämpfen. Ich bekomme einfach viel mit - gerade über meine Augen und vor allem Ohren, was ich gar nicht mitbekommen möchte. Ich ersticke oftmals in meinen Eindrücken und habe deshalb gelernt durch Stille und Meditation mich selbst vor gefährlichen, oft auch lebensbedrohlichen Lawinen voller Sinneseindrücken und Wahrnehmungen sowie den einhergehenden Gedanken und Gefühlen zu schützen. Dies war allerdings ein langer Weg und Mitte Zwanzig schien ich daran beinahe zu zerbrechen. Dies ist aber eine andere Geschichte.
Heute möchte ich euch noch zwei kleine musikalische Beispiele für meine Feinfühligkeit geben. Oftmals schon schrieb ich Texte und Musik passend zu inneren, unterbewussten Wahrnehmungen und Tendenzen, ja Stimmungen. Irgendwann mal 2015, als ich gerade Songs für mein „MA’AN“ Album schrieb, notierte ich in einem meiner Notizbücher folgende Zeilen:
Long is the river of memory
Strong is my longing for empathy
As I ride through my life
Fear is a well-fed enemy
Spread like a viral authority
In a world strangled by ties
Oh, but no longer
Oh, I’ve read the dice
Love is the only reality
In all the faces that I have seen
I could see, see the light
Oh, but no longer
Oh, let’s roll the dice
And I love to hug you under our bed
While the world is burning `round our heads
And I love to kiss you under our bed
While the world outside keeps going mad
Somehow things turned out differently
We’re stuck in a new kind of misery
As we ride through our lives
I still can’t buy into hate and greed
I still can’t buy into what they breed
No, we won’t run to seed
And I love to hug you under our bed
While the world is burning `round our heads
And I love to kiss you under our bed
While the world outside keeps going mad
Ja, Jahre vorm neuen Krieg oder der Pandemie fühlte ich schon ganz laut in mir, dass wir vor schwierigen Zeiten stehen. Prophetisch widerwillens und unfreiwillig - in meinen eigenen vielleicht besten Jahren. Genug Geld, gesund, ein wunderschönes Alltagsleben und Erleben. Ich zweifelte nicht an mir, meiner Lebenspartnerin Athena oder unseren Söhnen - aber ich wusste, der Schein trügt und die Menschheit rast mit hohem Tempo mal wieder in Richtung Stahlbetonwände. Ich sag nur „Fear is a well-fed enemy, spread like a viral authority.“ Und so wurde aus einem Liebeslied ein kleiner Song gegen die Apokalypse namens „Soon“, der auch groß werden hätte können, finde ich noch heute, und mit eurer Hilfe wird es ja vielleicht eines Tages noch, who knows. Acht Jahre sind seither vergangen. Hier ein Ausschnitt aus „Soon“ vom gemeinsam mit dem in London lebenden und wirkenden Produzenten Alex Beitzke produzierten Album „MA’AN“ - die ganze Version gibt es natürlich überall im Streaming und zum Download.
Und nun noch zu nem aktuellen Song. Ja, wie bereits in den letzten Ausgaben geschildert, schreibe ich derzeit wieder viel Neues, sitze gerne am Klavier und entführe mich selbst in meine innere Synästhetiker-Welt. Vor einigen Monaten wachte ich wie oft frühzeitlich auf fühlte mich irgendwie ähnlich wie damals bei „Soon“. Nur diesmal schrieb ich Wörter in meiner Muttersprache in mein Notizbuch. Letzte Woche habe ich den Song „Komm sag mir“ dann mal in einer ganz reduzierten Version (so mag ichs eigentlich immer am liebsten) hier bei mir im Green Meadow Road Studio am von Karl Schimpelsberger liebevoll frisch gestimmten und über hundert Jahre alten, moderaten Konzertpiano „Verdi“ von Lauberger und Gloss eingespielt. Ganz frisch und exklusiv nur hier nun für euch „Komm sag mir“ in voller Länge.
Ja, manchmal sehnt man sich einfach nur danach, dass man von außen von einer möglichst vertrauten Stimme so etwas wie „Es ist gut“ oder „Alles gut“ hört.
In diesem Sinne, es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar. Wir sind gut, bis nächste Woche, euer Axel
Es ist nicht das Ende
Im heutigen, ja wöchentlichen Kurzreferat habe ich keine spannenden, interessanten oder gar catchy Fragen für den Beginn parat. Ja, auch keine wertvollen, an irgendwelchen Wänden montierten Weisheiten oder Aphorismen wie letzte Woche. Außer vielleicht spontan die schöne, alte Bauernweisheit „Stirbt der Bauer im Oktober, braucht er keinen Winterpullover.“. Haha. Heute könnte es ernst werden - vermute ich gerade - ich hab so eine kleine Vorahnung, ja Vorwarnung an die HedonistInnen unter euch. Es mag sie ja immer noch geben, da draußen, in der großen, weiten Welt, die einem tagtäglich vorgegaukelt wird, aber seltenst hält, was sie verspricht.
Übrigens, da fällt mir gerade ein: Gestern am Abend, nach der, von meinen Jungs und mir wie immer mit Begeisterung sehr emotional verfolgten MotoGP-Übertragung, diesmal aus dem fernen Argentinien, sah ich in den stets und grundsätzlich mit Recht zu bezweifelnden ServusTV Nachrichten einen Beitrag zum Thema „Mutter“. Dort hieß es, dass man auf Krankenhaus- und Geburtsstationen-Websites sowie in thematisch nahen medizinischen Texten fortan nicht mehr den Terminus „Mutter“ verwenden darf. Weil sich dadurch „gebärdende Menschen“, die sich selbst nicht als Frau empfinden oder wahrnehmen, diskriminiert fühlen könnten. Alter Schwede. Für mich, hier in meiner 44-jährigen Lebenswelt ist dieser Terminus das wohl Urmenschlichste an sich. Ja, das wohl überall auf diesem Planeten erste Wort, welches frische, kaum zwei Jahre alte, also jüngste Menschen von sich geben ist „Mama“, also „Mutter“. Ja, klar „Mama“ sind wohl nur zwei aneinander gereihte Laute und „Mutter“ ein ganz großer Begriff. Aber wohin führt diese Diskriminierungsdebatte noch eines Tages? Ich finde, mit dem Terminus „Mutter“ ist derzeit ein neuer Zenith erreicht. Und dies sage ich als tatsächlich vollkommen weltoffener Mensch, der ich noch immer und schon zeitlebens bin. Tausende Beispiele dafür vorliegend. Schlicht lächerlicher Mumpitz.
Egal, diesen Pfad soll meine heutige Geschichte wohl doch nicht weitergehen. Nein, eher diesen Pfad - und jetzt kommt doch wieder eine Frage in mir auf: Wer von euch kennt nicht diese seltsamen, ja leeren, körperlich wie mental erschöpften und mit Zweifel an der Welt und sich selbst erfüllten Tage?
Ich habe heute so einen Tag. Autsch. Und ich hatte schon viele davon. Soll so sein, ist so. I can deal with it. Irgendwann im Todesjahr meiner Mum, ja meiner Mutter 2020 schrieb ich in mein Notizbuch folgende Worte:
Heut ist mal wieder einer dieser Tage
Wo ich wenig sage aber vieles hinterfrage
Die Liste ist lang, die Freude klein
Solls das schon gewesen sein?
Heut bin ich mal wieder in dieser Lage
Wo ich wenig wage und Lasten trage
Die Taten fehlen, die Wünsche groß
Wer bin ich und warum bloß?
Kann ich nicht zufrieden sein
Warum
Kann ich schwer alleine sein
Warum
Kann ich nicht alles und immer
Und warum wirds immer nur schlimmer?
Und so weiter und so fort. Hier die besagte Passage aus dem Song „Einer dieser Tage“ von meinem „ROMANTICK“ Album.
Aber wie so oft macht auch dieser Song von mir gegen Ende hin eine nicht unwesentliche und für mich essentiell wertvolle Kehrtwende mit den Worten:
Ein neuer Tag muss her!
So lange wir leben und erleben dürfen, darf das tiefe Tal, emotional wie körperlich, genau so sein, wie das wunderbare Hoch und hedonistische „Hooray“, „Jupidoo“ oder wie auch immer genannt oder gefühlt und menschlich erlebt, ja wahrgenommen.
Ich bleibe dabei: Das Leben an sich ist das größte, schönste und wertvollste Geschenk zeitlebens. Niemals per se in Geld zu messen. Aber klar, Geld regiert die Welt, I know.
Steve Jobs, zum Beispiel, war eine ganz besondere Ausgabe Mensch, ähnlich groß wie Einstein, Lennon, McCartney, Rubin, Cobain, Dalai Lama, Mandela, Gautama, Gandhi, etc. und grenzgenialer Innovator zeitlebens. Ich nutze seine Erfindungen seit 1998. Einer der Reichsten an Geld und Errungenschaften gemessen. Seine eigene, mir bekannte Lebensgeschichte tief bewegend an sich. Und dennoch wurde er nur 56 Jahre alt. Aus heutiger Sicht nur 12 Jahre älter als ich gerade hier und jetzt. Kein Geld der Welt konnte ihn damals am 5. Oktober 2011 vor seinem Ableben retten.
Es ist und bleibt ein endlicher Prozess, dieses Leben. Sich zeitlebens mit dieser de facto Endlichkeit selbst zu konfrontieren, ja bewusst zu beschäftigen, kann kein Fehler sein. Und bringt sogar wieder Leben ins Leben. Die große Kunst bleibt zeitlebens auch, der eigenen Fügung das Vertrauen zu schenken. Oder wie sagt Byron Katie so schön: „Life is happening for you and not to you“. Stimmt.
Vor gut zwölf Jahren schrieb ich in Los Angeles abermals spontan aus einem Moment heraus den Song „It’s Not The End“ und nahm ihn am Tag danach mit Danny Kalb und Jonathan „Butch“ Norton an den Drums im mir nicht mehr bekannten Studio in North Hollywood auf (siehe dazu auch meine Geschichte vom 7. März mit dem Titel „Der Morgenblick“). Damals eine textliche Nacherzählung aus vorangegangenen Erlebnissen und Situationen in Kalifornien. Dieser Song ist für mich die in Musik verpackte Erkenntnis, dass es immer wieder weitergeht. Ja fortan und ewig gilt die Devise: Aufstehen, Krone richten und weitergehen.
Und weil ich diesen, ja eigenen Song von damals selbst immer noch sehr schön finde, hier nun in ganzer Länge - ja es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist bekanntlich rar.
And „It’s Not The End…“ heißt auch, dass das körperliche Ende noch nicht das endgültige Ende ist…unsere Lebensenergie lebt weiter in jenen, die wir liebten.
Biss bald, euer Axel
Es liegt in deinen Händen, Tag ein und Tag aus
Direkt vor mir, hier in meinem wunderschönen Green Meadow Road Studio in Aschach an der Donau, hab ich mir stets im Blickfeld ein Zitat von einem der wohl besten Tennisspieler seiner Zeit (und wenn nicht sogar aller Zeiten) und beeindruckenden Menschen Arthur Ashe an die Wand geklebt. Drei Zeilen, die mich tagtäglich daran erinnern, dass man nur tun kann, was man im Moment und in weiterer Folge dann Schritt für Schritt tun kann - das Zitat lautet wie folgt:
„Fange dort an, wo du bist. Benutze das, was du hast. Tu, was du kannst.“
Klingt, wie so viele wertvolle Zitate und Weisheiten die mich berühren, auf den ersten Blick banal und vielleicht auch naiv. Denn Klarerweise sind wir alle tagtäglich auch vielen äußeren Fremdbestimmungen ausgeliefert. Gerade in Zeiten wie diesen oder wenn man die letzten paar Jahre retrospektiv betrachtet. Gerade für Menschen wie meine Lebenspartnerin Athena und mich waren die letzten paar Jahre gerade aufgrund der permanenten Fremdbestimmung zusätzlich fordernd und ja, nicht gerade witzig oder gar easy to handle. In der Pandemie zum Beispiel wurden wir quasi von heute auf morgen von erfolgreichen, selbstbestimmten Menschen und Eltern von drei neuen Österreichern zu Antragsstellern beim sogenannten „Härtefallfonds“. Alleine diese, von der damaligen Regierung und ihren de facto schauderhaften Witzfiguren (die meisten sind ja heute gar nicht mehr im Amt und haben sich ohne Konsequenzen in die lukrative Privatwirtschaft geflüchtet) gewählte Wortwahl für den Pandemie Fördertopf für EPUs und KMUs betrachte ich nach wie vor als nahtlose Frechheit. Als die Pandemie begann wurde das damals noch bestehende Epidemiegesetz sofort enthebelt und begleitet von der Lüge „Koste es, was es wolle“ mit dem u.a. Härtefallfonds ersetzt. Eine Farce, ja ein schlechter Witz ohne Pointe. Aber dazu möchte ich wahrlich heute nicht weiter meine Gehirnwindungen malträtieren. Wir sind immer noch da und wir gehen Schritt für Schritt und Tag für Tag weiter.
Eine große Kunst bleibt zeitlebens und tagtäglich auch, negative Energie, Gedanken und Gefühle wieder in positive zu transformieren. Und das besagte Zitat von Arthur Ashe hilft mir immer wieder genau dabei. Ich bin hier, im Jetzt. Ich fange dort an, wo ich bin. Ich benutze das, was ich habe und ich tue, was ich kann. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Und wie zitierte der von mir sehr geschätzte Eckhart Tolle in einem, vor kurzem von mir gehörten Podcast-Vortrag sinngemäß die Lehre des Siddharta Gautama so schön: „Life was never meant to be easy.“. Ja, der Hedonismus mag in unserer westlichen Welt ein großes, grundsätzliches Lebensziel sein - spielen tut es ihn aber de facto nicht, oder nur selten. Freiwillige vor und aufzeigen, bitte!
In meinem Studio habe ich noch drei weitere Zitate, vor ein paar Jahren aus einer Geo Philosophie Ausgabe ausgeschnitten und schlicht eingerahmt, an der Wand aufgehängt: „No hell below us, above us only sky“ von John Lennon, „Manchmal denke ich, es wäre besser, es gäbe keine Religionen“ vom Dalai Lama und „Ich bin ein tiefreligiöser Atheist“ von Albert Einstein. Auch schön und wertvoll, finde ich.
Aber nun weiter im Text und zurück zur heutigen Geschichte und dem einhergehenden Song aus meiner Feder mit dem Titel „In Your Hands“. Ich denke, es war im Jahr 2006, also vor bereits ca. 17 Jahren, als ich von einem damals sehr guten Freund und Musikerkollegen zwei CDs (für die jüngeren Podcast-Hörer unter euch sei kurz gesagt, dass dies so kleine silberne Scheiben sind, wo man Musik drauf speichern und in einem sogenannten CD Player abspielen kann) mit bereits digitalisierten Schallplatten mit Schlagzeug-Grooves und Beats gespielt vom legendären Schlagzeuger Bernard Purdie in die Hände gedrückt bekam. Ich war sofort vom Sound und dem 70er Jahre Drumming Style begeistert und machte mich ein paar Tage später sogleich ans Werk. Sprich, ich ging in mein Wiener United Indies Studio im Souterrain des Haarstil Salons und Kunstforums „folgeeins“ von Athena, suchte mir einen Beat, ja eine Groove von der Sammlung aus, legte diese am Mac, damals noch in Logic Pro, an und schrieb spontan einen Song dazu. Grooves und Beats, ja Rhythmen inspirieren mich bis heute zum Songs schreiben und sind stets ein Puzzlestein von vielen zu einem neuen Song.
Auf diese Art und Weise schrieb, performte und produzierte ich damals, ganz solo mio im Studio ca. 15 neue Songs. An die Entstehungsgeschichte jedes einzelnen Songs von damals kann ich mich bis heute noch erinnern, als hätte ich den letzten gerade fertiggestellt. Ja, das daraus resultierende Album „Wedding Songs“ liegt mir gerade auch deshalb noch heute sehr am Herzen. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, immer wieder völlig out of the blue etwas Neues, inspiriert durch einen großartigen Beat, zu erschaffen.
Einer der ersten Songs aus diesen „Wedding Songs“ Sessions war „In Your Hands“. Damals, 2006, war ich schon seit 2004 Vater von unserem ersten Sohnemann Laurin Finn und wollte schon seit längerem Athena einen Heiratsantrag machen. Ich wusste aber per se nicht wie. Ganz klassisch bei nem Abendessen oder so fand ich damals schon fad. Irgendwann, als ich schon mehrere Songs fertig hatte und erkannte, dass ich textlich immer wieder über meine Liebe zu Athena schrieb - siehe zum Beispiel der zweite Song am Album mit dem Titel „Saturday`s Bride“ oder „Taste of my Tongue“ - wurde in mir die Idee laut, dass ich das Album „Wedding Songs“ taufe und einhergehend damit ihr auch einen Antrag machen möchte.
Noch bevor ich dann tatsächlich via SMS am Sony Handy von damals die Frage „Willst du mich heiraten“ stellte, machten wir bei meinem Haus- und Hof-Photographen und Buddy Mischa Nawrata in Wien das Cover-Shooting fürs Album. Athena in Schwarz, ich in Weiß. Und auf der Rückseite des Artworks noch ihre verschränkten Finger, im Sinne von „alles nur fake“. Eigentlich, im klassischen Sinne betrachtet, sehr unromantisch. Aber heute umso romantischer, finde ich: Ein Typ, der zuerst ein ganzes Album schreibt und produziert, bevor er die Herzensdame endlich wirklich fragt. Athena hat mitgespielt und meine SMS schönerweise mit „Ja“ beantwortet. 2008 heirateten wir am Standesamt von Beverly Hills, 90210. Dass wir dann noch zwei weitere Burschen in die Welt setzen und in ein paar Tagen ganze 20 Jahre lang gemeinsam durch dieses Leben gehen ist eine andere, ja wertvolle, schöne Geschichte. Dazu sicherlich noch irgendwann mehr im Rahmen meines ROMANTICK Podcasts - er und ich sind ja noch jung. The best is yet to come, sagte ich ja schon vor zwei Wochen hier an dieser Stelle.
In einem meiner Notizbücher von 2006 notierte ich damals folgende Worte:
Don’t know where I am
Don’t know how to go on, for so long
Don’t know what to say
Just feel the decay in my heart
I know it’s all ending
Stop the pretending
It’s all in your hands, day in and day out
We all are depending on what we are sending
It’s all in your hands
Don’t know who to trust
The patient is lost, he passed by
But, nobody cares
Indifference is what we’re here for
I know it’s all ending
Stop the pretending
It’s all in your hands, day in and day out
We all are depending on what we are sending
It’s all in your hands
And there’s no way out
Hier ein kurzer Auszug aus dem Song zum Reinhören - als Ganzes ist er natürlich auf sämtlichen Plattformen wie Spotify und Apple Music verfügbar. Die besagte Limited Edition Digipak CD gibts übrigens auch noch - also wer eine möchte, bitte einfach eine Email an office@axelwolph.com schicken.
Ja, das Leben liegt in unseren Händen. Tag ein und Tag aus. Ob man nun will oder nicht. Egal, ob selbst- oder fremdbestimmt. Damals wusste ich eigentlich noch nicht wirklich, was diese Worte einmal für mich bedeuten könnten oder würden. Ich schrieb einfach aus meinem Empfinden heraus einen Songtext, weil ich ihn für den frischen Song im Studio brauchte. Einfach ein paar Zeilen, unüberlegt und spontan, wie meistens.
Als ich dann 2007 mit dem fast fertigen, noch ungemasteren Album im Gepäck nach Los Angeles flog, hatte ich tatsächlich das Gefühl, etwas Besonderes geschaffen zu haben. Nicht nur für mein privates Leben, sondern auch generell. Ich dachte damals wirklich, die Welt da drüben wartet auf mich und ich müsste nur die richtigen, ja passenden Menschen treffen, um den noch nötigen Support zum Weltruhm zu erfahren. Damals war ich wahrlich noch gefangen in der „Axel, du bist was ganz Besonderes“-Blase. Ich war wirklich noch fast jugendlich und jedenfalls postpubertär motiviert und freute mich auf die sogenannte große, weite Welt. Ich bezahlte eine US-Radio-Promotion-Agentur und freute mich über Airplay, ja Rotation auf ca. 90 von den bemusterten 140 Radiostation an der US Westcoast. Bei manchen, auch großen Stationen schafften es meine Hochzeitslieder sogar in die Airplay-Charts und ließen damals große und namhafte Major-Produktionen wie The Hives zum Beispiel hinter sich. Eine schöne Anekdote, find ich.
Und ich lernte mit meinen „Wedding Songs“ auch tatsächlich sehr interessante Leute kennen. Wie zum Beispiel Brad Aarons, seines Zeichens damals Chef A&R Manager von BMG Publishing, wo ich damals durch Walter Gröbchen zu nem Autoren-Exklusivvertrag kam. Brad lud mich unmittelbar ein, in seinem Head-Office in Beverly Hills (gleich gegenüber von BMW Beverly Hills - dies fand ich damals beim Parken meines PT Cruisers irgendwie witzig, komme ich doch aus einer väterlich beeinflussten BMW Familie…) vorbeizuschauen mit meinen „Wedding Songs“.
Zuerst meinte er für A&R Typen zutreffend „Okay, let’s hear one song!“. Ich spielte ihm unter furchtbarem Zeitdruck und seltsamer Anspannung im Chef-Büro meinen Song „Gravity“ vor. Diesen hörten wir dann gleich dreimal hintereinander. Es folgte eine fast eineinhalbstündige Listening-Session über mein ganzes Hochzeitsliederalbum. Bei „In Your Hands“ meinte er schlussendlich: „This one is perfect for ‚Grey’s Anatomy‘“. Die Serie war damals ziemlich frisch und Brad hatte direkten Zugang zur Song-Bemusterung, ja -Ausstattung für diese Krankenhausserie, die ich noch nicht einmal kannte damals. Die Band Snow Patrol wurde auf diesem Weg mit ihrem Song „Chasing Cars“ weltberühmt - ich war also knapp dran.
Ich fuhr damals wie beflügelt wieder heim zu Nina, meiner Photographin & Landlady in Sylmar, am nördlichen Ende des Valleys. Ich dachte damals wirklich, mein Traum von der großen, weiten Welt könnte aufgehen.
Vielleicht blauäugig, aus heutiger Sicht betrachtet. Aber alles kommt bekanntlich erstens immer anders und zweitens als man denkt.
Nun gut, to make a long, supposed to be beautiful, story short. Eine Woche später sagte mir Brad, dass BMG Publishing gerade von der Universal Music Publishing Group gekauft wurde und er somit das Feld räumen muss. Wir blieben noch ein paar Jahre danach im Kontakt, hatten aber nicht mehr wirklich bzgl. meiner Musik miteinander zu tun. Er managte ein paar Jahre exklusiv den Songkatalog von Guy Chambers, seines Zeichens der Songwriter und Produzent von Robbie Williams bis er dann, so weit ich mich erinnern kann, zum Warner Chappel Verlag wechselte. Egal.
Mein „Wedding Songs“ Album blieb meine kleine romantische Hochzeitsliedersammlung und wurde in meiner Heimat Österreich bis heute kaum bis niemals im Radio gespielt. Einzig und alleine mein damaliger Freund und Unterstützer Eberhard Forcher versuchte Songs wie „Stop Telling Me“ und so weiter im „Hitradio Ö3“ zu platzieren und ja zu pushen.
Jetzt, aus heutiger Sicht nur eine kleine Geschichte aus meinem Sein und Schaffen.
Das, auf YouTube nach wie vor verfügbare Musikvideo hab ich damals spontan auf Ninas Terrasse bei Sonnenuntergang in Boxershorts unten und weißem Anzug und Krawatte oben gedreht - mit meiner MiniDV Sony Handycam in unpackbar schlechter Qualität im Vergleich zu heute. Ich fand damals die Idee, einen ganzen Kalifornischen Sonnenuntergang zu diesem Lied in Echtzeit zu filmen gut. Meine große, weiße 70s Brille ist natürlich ein anderes Thema. Ein Freund in Wien sagte immer „Skibrille“ dazu. Haha.
Und ja, es ist nur ein Lied. Es sind nur ein paar Worte. Es ist nur ein Leben, aus dem ich hier spontan erzähle, aber es gilt die Zeit zu nützen, denn, wie gesagt, sie ist rar. It’s all in your hands, day in and day out…auch bis nächste Woche und darüber hinaus, euer Axel, bye bye.
Amen
Ich beginne mein neues, wöchentliches Kurzreferat spontan ähnlich wie letzte Woche mit einer Eingangsfrage: Weißt du eigentlich, was „Amen“ bedeutet? Nun, ich muss gestehen, ich nicht wirklich. Also, ja, klar, natürlich bin auch ich, wie viele hier in meiner Heimat, mit dem Christentum aufgewachsen. Vom Papier her war ich von Geburt an mit römisch katholisch gekennzeichnet. Ja, ich bin im Unterschied zu meinen drei Söhnen getauft und gefirmt und war bis zu meinem Auszug aus dem Elternhaus mit 19 Jahren natürlich auch völlig und ganz in die christliche Tradition zwangsmiteingebunden. Kein Problem damit, gar nicht, und ich möchte heute, hier und jetzt auch keine vollkommen unnötige, abertausendste Glaubensdiskussion lostreten - Gott behüte!
Ich muss aber schon eingestehen, dass eine meiner ersten selbständigen, postpubertären Errungenschaften in Wien damals war, aus der sogenannten Kirche auszutreten. Ich fühlte mich damals als Neuankömmling in der großen, neuen Stadt dieser Glaubensgemeinschaft irgendwie endgültig nicht mehr zugehörig. Das darauf folgende, ja, belehrende Gespräch mit einem Pfarrer aus der Pfarre Penzing werde ich wohl nie vergessen können. Eigentlich Kabarett pur. Heute würde ich sagen: skurril, witzig. Aber auch darauf möchte ich natürlich heute nicht weiter eingehen. Schade um die wertvolle, wöchentliche Schreibenszeit über dies und das für meinen Podcast, der wahrscheinlich ja auch mal als kleines Taschenbuch für unterwegs oder zum Einschlafen erscheinen wird.
Natürlich habe ich vorab wie immer ein bissl recherchiert zum Thema von heute. Aber wirklich nur kurz. Auf Wikipedia viel mir dieser Satz auf: „Amen bedeutet (…) viel mehr als die übliche Übersetzung „so sei es“, weil zum einen das Hebräische weder eine Konjunktiv- noch eine Indikativform des Verbs „sein“ im Präsens kennt. Zum anderen braucht Gott nach dem jüdischen Gottesbild unsere Billigung oder Zustimmung zu vorgetragenen Hymnen, Danksagungen und Fürbitten nicht. Wichtig ist hingegen, dass das Gemeindeglied im jüdischen Gottesdienst durch sein beherztes „Amen“ sich dem Gehörten durch seine persönliche Anteilnahme entschieden anschließt und in der Gemeinschaft bekennt, dass das Gehörte für ihn persönliche Gültigkeit besitzt."
Und so weiter und so fort, hallelujah! Ob Christentum oder Judentum oder was auch immer. Ich bleibe nun lieber bei meiner eigenen Erfahrung mit diesen vier Buchstaben. Wir waren damals vor ein paar Jahrzehnten als Familie meistens nur zu Weihnachten bei der Christmette und hörten meinem Vater bei seiner lauthals und typisch weihnachtlich leicht angeheiterten, stark Beatles beeinflussten Gesangsperformance zu „Vater unser“ (wie zutreffend) zu. Ein ganz besonderes Schauspiel und Erlebnis, Jahr für Jahr. Mir imponierte abseits davon immer das, von allen Gläubigen im Kirchenschiff mehrmals während so einer Messe meist laut ausgesprochene „Amen!“. Dies klang für den kleinen Axel schon groß und mächtig im Kirchenhall nach. „Was für ein mächtiges Wort!“, dachte ich damals, ohne zu wissen, was es genau bedeutet. Es klang für mich immer wie eine Art von Bestätigung. Als eine Art von finaler Zustimmung zu vorher Gesagtem oder ja, Gepredigtem. Und zeitlebens habe ich dieses Wort, auch als Nicht-Christ, fortan weiterverwendet. Egal ob in Wien, Los Angeles oder nun seit bald schon wieder neun Jahren hier am Land in Aschach an der schönen Donau. „Amen“ kommt immer wieder vor, im alltäglichen Sprachgebrauch, immer dann, wenn ich irgendwem zu irgendwas meine Zustimmung aussprechen möchte. Wahrscheinlich Blasphemie, aber who cares…
Im wunderbaren Buch „Nada Brahma - die Welt ist Klang“ aus dem Jahr 1983 vom Musikjournalisten und Musikproduzenten Joachim-Ernst Berendt sinniert der Autor an irgendeiner Stelle seines Werkes mal über die Bedeutung von „Amen“ und dem im mir näher gelegenen Buddhismus gebräuchlichen „Om“. Die genaue Stelle suche ich jetzt sicherlich nicht raus, aber mir blieb in meiner Erinnerung übrig, dass er zum Schluss kam, dass „Amen“ unterm Strich nichts anderes bedeutet als „Danke“. Dies mag natürlich jetzt dem einen oder anderen Sprachwissenschaftler viel zu billig und naiv sein, aber ich mochte schon damals seine eigene Erkenntnis und teile sie auf gewisse Weise irgendwie bis heute. I can deal with it. Ich wiederhole mich: Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Vor ungefähr zwei Jahren schrieb ich einen neuen Song mit dem Titel „Amen“. Wie immer, quasi völlig out of the blue einen Text zu ein paar Akkorden an der Gitarre. Eigentlich zu einem althergebrachten, ja old school Rock-Gitarren-Riff, welches ich gerne spiele, wenn ich eine Gitarre auf der Bühne soundchecke oder erstmals in die Hände bekomme. Aber irgendwie passte, wie so oft, zu diesem Zeitpunkt x auf der Zeitachse für mich alles zusammen und ich baute aus den mir vorliegenden Text- und Musikbausteinchen ein neues Lied zusammen und notierte in meinem Notizbuch folgende Worte:
Keiner trägt die Last in meinen Sandalen
Keiner wütet in mir wie meine Vandalen
Keiner hat das Recht mir das zu sagen
Keiner hat die Kraft mich so zu schlagen
Doch jeder schlägt sich gut
Da fehlt es nie an Mut
Ich geb dem Kind nen Namen
Amen
Keiner darf die Welt je umarmen
Keiner mit zum Himmel gestreckten Armen
Keiner niemals nimmer nie und wieder
Keiner schreibt die schönsten Schubladenlieder
Doch jeder singt sie mit
Jeder folgt dem Schritt
Ich geb dem Kind nen Namen
Amen
Keiner ruft mich an um mir zu sagen
Keiner wird die Last der Welt je tragen
Keiner hält sein Glück in seinen Händen
Keiner fragt sich wird das Schiff noch wenden
Doch jeder rudert mit
Jeder singt den Hit
Ich geb dem Lied nen Namen
Amen
Ich nahm wie immer ein Akustik-Layout des Songs hier bei mir im Studio vor meinem schönen Neumann U47 Klon von Wunderaudio auf und bereitete somit die Aufnahmen fürs Romantick-Album mit David, Tom und Mario vor. Wie das Ganze fertig aufgenommen und produziert klingt, möchte ich euch diesmal ausnahmsweise zur Gänze vorspielen - keine Angst, es dauert nur dreieinhalb Minuten. Nicht weglaufen, mein Aufsatz von heute geht danach gleich weiter…
Irgendwie ist aus dem Text und dem Gitarrenriff ein old school Rocksong geworden und hat auch, wie ich meine, eine Brise meiner damals jahrelang inhalierten Kalifornischen Luft und Sonne abbekommen. Für mich klingt das Ergebnis ein bissl wie ein Tom Petty Song in deutscher Sprache, obwohl ich selber kaum bis nie in solchen Schubladen denke. Ich mache einfach nur, beeinflusst und inspiriert durch dies und das und das Jetzt.
So wie auch dieser Text, hier und jetzt gerade wieder passiert. Es muss nicht immer alles tausendfach reflektiert, überprüft und nachhaltig belegt sein. Man darf auch immer wieder mal frei drauf los schreiben, singen, tanzen, springen oder was weiß ich wonach dir oder mir gerade ist. Das Leben passiert im Jetzt. Banal, aber so schön wahr. „Life is now“, schrieb ich vor mittlerweile fast drei Jahrzehnten in eines meiner zahllosen Notizbücher. Einen Song mit diesem Titel gabs bis jetzt noch nicht. Ich hab ja noch Zeit, behaupte ich zuversichtlich.
Am kommenden Freitag, dem 24. März 2023 feiert mein Vater seinen sage und schreibe 75. Geburtstag. Ja, mein geliebter Vater und Ex-Showman (seine Beat-Band in den 1960er Jahren hieß so), in der letzten Ausgabe liebevoll männlicher Genspender genannt, wird ein Dreiviertel Jahrhundert alt. Schon unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht - sei es für mich als seinem einzigen Sohn oder natürlich noch viel mehr für ihn selbst. Der Verlust seiner Lebenspartnerin, ja meiner Mum, hat uns allen hier ordentlich zugesetzt, aber er hält sich gut, macht viel Sport und Bewegung, studiert viele wertvolle Bücher und ist mir und meiner neuen Familie eine tagtäglich große Stütze. Ja, der Taxibetrieb Apo holt und liefert nahezu täglich unsere Söhne von Sportstätte zu Sportstätte oder Schule zu Musikschule, etc. Und dies ohne Taxi-Schild am Dach. Er hilft uns und wir helfen ihm. Wir sind da, im Jetzt, und sagen uns oftmals gegenseitig: „Morgen ist ein neuer Tag“. Da mein Vater ein wöchentlicher Hörer und Leser meines Podcasts ist, hier kurz im Namen meiner Family direkt an dich gerichtet: Apo, wir lieben dich. Apo heißt er familienintern übrigens deshalb, weil Matti als Zweijähriger sämtliche Worte von hinten nach vorne aussprach. Und so wurde „Opa“ zu „Apo“. So einfach geht das.
Zur Feier seines Jubiläums veröffentliche ich am 24. März, also kommenden Freitag, meinen Song „Amen“ im Sinne eines ganz großen „DANKE“.
Wir haben vor ein paar Wochen in unserem Winterdomizil Mojacar/Andalusien, spontan wie immer, inspiriert durch die sogenannten „Carpool Karaoke“ Videos von James Corden aus Los Angeles, ein „Family Carpool Karaoke“ Video zu „Amen“ gedreht. Im Mietauto-Van am Weg zur wunderschönen Rennstrecke „Circuito de Almeria“, wo ich schon so viele, schöne und manchmal auch schnelle Runden auf nem Moped drehen durfte. Und dort, an dieser Rennstrecke erfuhr ich am 12.1.2020 vom Ableben meiner Mum. Es schließen sich somit ein paar Kreise und ich wünsche mir sehr, dass ich mit meinem Vater eines Tages noch gemeinsam dorthin reisen darf. Am besten mit meinen Söhnen, ja seinen Enkeln und meiner Lebenspartnerin Athena.
Denn wie ihr mittlerweile wisst: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar. Amen.
Das Fremde in uns
Wusstest du, dass der Schimpanse und der Mensch genetisch verwandter sind als der Afrikanische und Indische Elephant? Oder wusstest du, dass aus einem menschlichen Elternpaar mehr als sieben Millionen unterschiedliche Kinder, ja individuelle, neue Menschen entstehen könnten? Wusstest du, dass wir alle - Inzuchtkinder mal ausgenommen - Kinder von zwei ursprünglich Fremden sind?
Ich finde solche Fakten und dadurch genährten Überlegungen immer wieder überraschend, geistig erfrischend und auch berührend. Alleine, wenn man bedenkt, wie unfassbar wichtig sich der Mensch selbst nimmt - sind wir doch alle unterm Strich nur Affen mit einem etwas zu großen Hirn, meistens weniger Körperbehaarung und meistens einem etwas aufrechteren Gang. Klar, Schimpansen sind evolutionär betrachtet bei der Verwendung von einfachsten Werkzeugen wie Steine und Stöcke stehen geblieben, der Mensch hat so beachtliche Dinge erschaffen wie das Flugzeug, die Golden Gate Bridge, „Imagine“, das Klavier, den „Wanderer über einem Nebelmeer“, das Motorrad oder den Tennisball - um spontan nur ein paar Kleinigkeiten zu nennen. Und trotz aller Geniestreiche bin ich mir bis dato noch nicht ganz sicher, ob der Schimpanse unterm Strich nicht doch die wesentlich intelligentere Version der beiden Affenarten ist und bleibt. Nur, weil sich der Mensch selbst für wichtiger, besser und wertvoller hält, muss es noch lange nicht so sein. Auf die Frage „Mit welchen Waffen wird der Mensch im dritten Weltkrieg kämpfen?“ antwortete, der von mir so geschätzte Albert Einstein in den 1940er Jahren einmal mit den Worten: "I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones.“ Da wären wir dann also wieder auf der gleichen Ebene wie unsere nahen Verwandten. Und wenn man sich die Geschehnisse auf diesem Planeten derzeit ansieht, bekommt man schnell den Eindruck, dass sich viele Abarten und Mutanten der Menschheit dieses Werkzeug wieder sehr bald herbeisehnen. Schauderhafter Wahnsinn. Tagtäglich. Aber da möchte ich gedanklich heute, hier und jetzt wahrlich nicht hin. I don’t wanna go there…
In meinen wöchentlichen Kurzreferaten und Aufsätzen geht es bekanntlich um andere Gefühle, Gedanken und Geschichten. Ich schaue nur mehr ganz selten bewusst Nachrichten und versuche stattdessen viel lieber mein Dasein als Mensch so gut wie mir möglich zu erfüllen.
Übrigens: Seit gut zwei Wochen höre und studiere ich das Hörbuch „The Creative Act: A Way of Being“ von Rick Rubin, in der englischen Originalversion sogar von ihm selbst grandios eingesprochen. Und ja, ich schätze diesen Mann schon seit meinen musikalischen Anfängen vor ca. 30 Jahren sehr. Sein eigenes Buch fühlt sich für mich beinahe wie eine Bibel an. Und dies, obwohl ich keinen Fanatismus von mir kenne. Er spricht mir einfach aus der Seele und dafür bin ich ihm unbekannterweise sehr dankbar. Ich lege jedem Künstler, nicht unbedingt nur Musikern, dieses Buch oder Hörbuch ans Herz. Und es beflügelt mich auch wieder, meiner großen Leidenschaft Musik wieder stärker nachzugehen. Nichts schöner, als aus dem Nichts etwas Hör- und Erlebbares zu erschaffen. Meine Selbsterkenntnis von vorhin, ja, tagtäglich mein Dasein als Mensch so gut wie mir möglich zu erfüllen, hat sich mittlerweile auch schon in einer von vielen neuen Songideen manifestiert. Da singe ich schönerweise mit einer wunderschönen Melodie in Verbindung im Memo am über hundert Jahre alten Lauberger und Gloss Concertpiano die Zeile „I wanna be the best version of me. I wanna be as good as I can be.“ Und jedes Mal, wenn ich mir dieses Songmemo am Klavier anhöre, rührt es mich zu Tränen. Weil genau DAS, möchte ich täglich am liebsten sein - für mich und jene Menschen, die ich liebe: the best version of me.
Ja, ich schreibe wieder und ich freue mich schon wie der fünfjährige Bub damals aufs Christkind (eigentlich auf die Geschenke, aber egal) auf die kommenden Aufnahmen. Ich möchte meine bisherigen musikalischen Welten und Stile alle miteinander vereinen. Egal ob instrumentale Musik, also mit oder ohne Lyrics in englischer oder in deutscher Sprache. Alles was ich bin, denke und fühle, möchte ich zum Klingen bringen. Alles zu einem Ganzen vereinen - alles was ich als Musiker, Mensch und Künstler bin, darf sein. Keine Restriktionen von außen, keine fremden Belehrungen, keine Zurechtweisungen, keine inhaltslosen Erfolgskonzepte, keine Aufklärungen und keine Gedanken darüber, ob und wie Musik kommerziell erfolgreich sein könnte oder müsste. So wie es auch Rick Rubin sinngemäß so schon am Punkt formuliert: „First there is the art, then there is you, the audience always comes last.“ Wenn man sich selbst und die eigene Kunst tatsächlich ernst nimmt und leben möchte - und wir reden hier noch lange nicht von Egomanie oder so nen Scheiß - dann nimmt man sich im Zuge des Schaffens und Erschaffens ganz bewusst und gesund von derlei Gedanken und Umgebungen raus. Tag für Tag formt sich mein inneres Bild meiner neuen Musik immer mehr. Sie wird sehr laut und auch sehr leise, weit und intim, eingängig und sperrig. Ich möchte meine musikalische Sprache weiterentwickeln, wieder mutig sein, experimentieren und Dinge wieder bewusst falsch machen. Ich möchte meine Comfort-Zonen verlassen, wahrlich kreativ sein und nicht so wie bei meinem „Romantick“ Album möglichst vielen gefallen, ja nichts falsch machen und mit angezogener Handbremse auf einem mir ewig bekannten Rundkurs neue Bestzeiten erzielen wollen. Eine billige Metapher, ich weiß, aber zutreffend und vor allem für mich als noch lebender Künstler von Wert. Ich lebe, also bin ich. Ich fühle, also bin ich. Ich liebe, also bin ich. Ich schaffe, also bin ich. Dies heißt nicht, dass ich mit den zuletzt veröffentlichten Songs als solches nicht zufrieden bin - nein, auch den Sound finde ich gut. Das abgelieferte und veröffentlichte Material ist ein Spiegel dieser von mir durchlebten Zeit nach dem Ableben meiner Mum, die Zeit der Pandemie, die Zeit von großer und permanenter Fremdbestimmung von außen. Ich kritisiere hier einzig und alleine mich selbst in der Retrospektive. Ja, auch kritische Selbstwahrnehmung ist Teil des Künstlerseins. Es ist ein Weg der Erfüllung und des Scheiterns. Dass viele damit nicht umgehen können, ist verständlich, geht mich aber unterm Strich nichts an. Wie sagte mein spiritual teacher Alexander in Wien damals so schön: „Was jemand anderer von dir denkt, geht dich grundsätzlich nichts an - es ist seine oder ihre Privatsphäre.“
Ehrlichkeit zu sich selbst ist wahrlich keine weitverbreitete, menschliche Eigenschaft. Sie tut oft schlicht weh und deshalb wird sie vermieden. Ich habe auch lernen müssen, dass man kritische Selbstbetrachtungen am besten niemals mit anderen Menschen teilen sollte. Jedenfalls nicht in der emotionalen Intensität, wie sie meistens de facto stattfindet. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich immer wieder aufstehe und weitergehe. Gerade deswegen! Und ich halte das „Romantick“ Album als Vinyl und CD immer noch gerne in den Händen - auch mit Phreude in Verbindung. Aber eins ist auch klar: the best is yet to come. Es ist noch nicht aller Tage Abend und viel Neues gedeiht gerade in mir.
Dies bringt mich sogleich zu meiner zweiten Eingangsfrage von heute: Wusstest du, dass aus einem menschlichen Elternpaar mehr als sieben Millionen unterschiedliche Kinder, ja individuelle, neue Menschen entstehen könnten? Schon beachtlich, oder? Von den ca. sieben Millionen Möglichkeiten von Athena und mir sind drei real geworden. Diese drei Genkombinationen und neue Lebewesen dürfen wir nun hier lebendig erleben und in ihr eigenes Leben begleiten und unterstützen. Herrlich, wenn oft auch sehr fordernd und manchmal auch überfordernd - dies liegt aber seltenst an ihnen selbst und meistens an den üblichen äußeren Fremdbestimmungen. Denkt man das hiesige Schulsystem, so wird einem schnell klar, dass Konformität immer noch größer geschrieben wird als Individualität. Aber wem sag ich das. Mein männlicher Genspender meinte einst Mal zu mir: „Es ist schon unglaublich, aus welchem Schleim ein Mensch entsteht!“ Dies finde ich bis heute, ja witzig und ja, er hat recht damit. Das Wunder Leben ist und bleibt das Wunder Leben. Und das Leben ist und bleibt überall, egal ob wir, also du oder ich nun existieren oder nicht. Das Leben ist das Ist und wir haben es nur für unsere Lebenszeit geliehen, ja geschenkt bekommen. Schon grandios.
Dies erinnert mich gerade an ein Erlebnis als kleiner Bub, damals bei unsrem Teich im Steinbruch mit Höhlen Garten meiner wildromantischen Kindheit. Schon damals angelte, oder wie man hierzulande sagt, fischte ich gerne. Auch in unserem kleinen Teich mit Rotaugen, Karpfen und Hechten und allem was dazu gehört. Eines Tages fing ein damaliger Kinderfreund von mir (wenn ich ihn heutzutage irgendwo auf der Straße gehen sehe, bin ich immer wieder aufs Neue verblüfft, dass dies der selbe Mensch von früher ist, nur mehr als dreißig Jahre später…) einen schönen, ca. 60-70 Zentimeter großen Hecht. Meine Mutter war begeistert und somit wurde der beachtliche Fang nicht wieder in den Teich entlassen, sondern vom erfolgreichen Kinderfreundfischer getötet und filetiert. Er drückte mir dabei plötzlich das zur Gänze ausgelöste Herz des Hechtes in die Hand. Ekelhaft, dachte ich zuerst. Zu meinem großen Erstaunen schlug dieses noch. Und zwar noch lange - meiner Erinnerung nach über zwei Stunden lang. Einfach nur ein kleines Fischherz, ohne Körper, ohne irgendwas. Ich war echt zutiefst erstaunt und berührt davon, wie stark das Leben an sich sein kann beziehungsweise ist. An den Gedanken „Wow, ich habe auch so ein Herz!“ kann ich mich auch noch erinnern. Ich fühlte mich plötzlich unbeschreiblich verbunden mit diesem anderen Lebewesen. Und ich fragte mich: „Was lässt diesen seltsamen, kleinen Fleischhaufen schlagen, ja an- und entspannen?“ Als das Herz dann in meiner Hand schließlich zu schlagen aufhörte wurde ich traurig - und auch an diese Traurigkeit, kann ich mich heute noch gut erinnern.
Und bevor dies jetzt zur schauderhaften, fast schon „Wednesday“ (ja, diese Netflix Serie haben wir tatsächlich gerade als Familie geschaut und für empfehlenswert befunden) mäßigen Grusel- und Trauergeschichte wird, möchte ich noch zur dritten Eingangsfrage von heute kommen. Ich drehe die Frage aber zuerst zu einer klaren Erkenntnis um: Jeder von uns ist das Ergebnis von zwei ursprünglich fremden Menschen. Ja, natürlich, ich sage es jetzt besser nochmals dazu, Inzuchtkinder mal ausgenommen. Ich rede aber hier jetzt nicht von abartigen Ausnahmen der Gegenwart oder gar der gruseligen habsburgerischen Familien-Vorgeschichte unseres Landes, sondern von den meisten, ja üblichen Fällen, wie neues menschliches Leben entsteht. Auch jeder Nazi oder rassistischer, fremdenfeindlicher Vollidiot (natürlich auch gegendert gültig), der Fremdes gezielt oder unbewusst, also schlicht dumm verwendet, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen, entspringt dem Erbgut zweier ursprünglich Fremder. Lustig, oder? Die Menschheit ergibt in ihrer Diversität und Individualität ein großes Ganzes. Wer dies bis heute noch nicht begriffen hat, steht wohl evolutionär noch eher auf der Stufe des Schimpansen, wobei ich natürlich keinem unserer so nah verwandten Affenkollegen so etwas wie Rassismus unterstellen möchte. Wie es bei den Schimpansen allerdings mit Inzucht aussieht, weiß wohl die beachtliche Schimpansenforscherin Jane Goodall am besten. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Egal, ob nun Indischer oder Afrikanischer Elephant, egal ob ein kleiner Schimpanse oder einer meiner drei Söhne, egal ob ein Hecht im Nirgendwoteich oder der beeindruckende Rick Rubin, egal ob Einstein oder ein hirnverbrannter Rassist, egal ob meine Lebenspartnerin oder ein neuer Fremder, der oder die schon nach kurzer Zeit zu einer neuen Vertrauensperson werden kann. Wir alle haben diese Lebenszeit nur geliehen, ja für ein paar Jahre oder Funken des ewigen Lebens geschenkt bekommen. Wir alle haben die Chance, die beste Version von uns selbst zu sein. Und demnach gilt es die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Der Morgenblick
Heute möchte ich ganz bewusst und absichtlich meine Gedanken und Gefühle, ja meine Wahrnehmung in diesem Moment in Richtung Musik lenken. So viel Egomanie sei mir bitte zumindest für heute und diesen Beitrag verziehen - natürlich in die Richtung meiner eigenen Musik bisher. Aber keine Angst, ich habe nicht vor, einen Aufsatz über mein bisheriges Gesamtwerk zu schreiben, dies wäre dann wohl doch etwas zu umfangreich und ein viel zu großes Vorhaben für meinen wöchentlichen Aufsatz zum Thema ROMANTICK - Gefühle, Gedanken und Geschichten.
Nein, schon von Beginn an hatte ich vor, mit meinem Podcast auch auf einzelne Songs meines musikalischen Schaffens einzugehen. Viele von euch, die mein wöchentliches Kurzreferat verfolgen sind auch Fan meiner Musik und dies freut mich wirklich sehr. Und diese hat natürlich eine längere Vorgeschichte als das aktuelle, erstmals rein deutschsprachige Album „Romantick“. Wie schon mehrmals erwähnt habe ich nach dem Ableben meiner Mutter (die übrigens morgen am 8. März ihren 74. Geburtstag hätte), ihrem Wunsch zufolge auch mal was zu schreiben und singen, das sie auch gleich verstehen könnte, Songs in meiner Muttersprache geschrieben und auch veröffentlicht. Die ersten drei Songs, „Vorüber gehen“, „Es regnet“ und „Immer da“ der zutreffend „Muttersprache“ genannten EP aus dem Jahr 2021 waren drei ganz neue und frische Songs, die ich unmittelbar in den Wochen nach Mums Tod, am 12. Jänner 2020, hier in meinem The Green Meadow Road Studio geschrieben und als Akustik-Layouts aufgenommen hatte. Realisiert, ja fertig produziert hab ich dann die Songs für die EP und das folgende Album „Romantick“ gemeinsam mit drei Musikerfreunden, die per se als Person und Musiker kaum unterschiedlicher sein könnten: Am Schlagzeug mein langjähriger Drummer und Weggefährte Mario Lackner (er spielte auch schon zu vielen meiner englischsprachigen Songs), am Bass und an der Gitarre zwei absolute Neulinge für meine Musik, die die Fügung offenbar speziell für diese Songs zu mir schickte: Tom Niesner aus Wien und David Loimayr aus meiner neuen, alten Heimat Aschach an der Donau. Im Unterschied zu meinen bisherigen Alben, hab ich zu den deutschsprachigen Songs hauptsächlich Akustikgitarre gespielt und gesungen. Aufgenommen haben wir diese, auch aufgrund der Covid-Lockdowns von Studio zu Studio und nicht wie bisher alles in meinem Studio.
Aber damit möchte ich euch jetzt nicht weiter quälen, vielleicht mal zu einem späteren Zeitpunkt x auf der Zeitachse hier auf meinem Podcast dazu mehr, who knows? Ich möchte nun textliche Meter machen in Richtung „Morning View“, meinem Song für meine heutige Geschichte. Ja, auf Deutsch hätte der Song wohl „Morgenblick“ geheißen. Aber damals, ich glaube und denke es war 2011 in Los Angeles, schrieb ich Songs noch in der weit verbreiteten Weltsprache. Ich war damals unmittelbar vertraut und verbunden mit dieser Sprache, wenn ich eine neue Songidee hatte. Auf Deutsch zu schreiben, kam mir damals quasi nie in den Sinn. Aber ich liebte und schätzte damals schon den ersten Blick am Morgen, ja die erste visuelle Wahrnehmung nach dem Aufwachen. Diesen ersten, frischen Blick auf den neuen Tag. Auch damals lebte ich offensichtlich schon mein Lebensmotto „Life is a daily story“ und hatte wohl schon begriffen, dass mein Leben nicht als Ganzes, sondern vielmehr als eine Ansammlung von einzelnen Tagen zu betrachten und erleben ist. Klar, nicht einfach und vielleicht auch naiv, aber als Grundeinstellung immer noch brauchbar und wahrlich sinnbringend. Bis heute. Und heute ist übrigens mein 16118er Lebenstag. Wow. Die Inspirationsquelle für den Song und die Lyrics war damals ein frühmorgendlicher Skype Videocall mit Athena und meinen beiden Söhnen Laurin und Matti. Noch gefangen in meinen morgendlichen Alphawellen, ja fast noch im Halbschlaf war ich von deren Antlitz am fast anderen Ende der Welt zutiefst bewegt. Ich weiß noch genau, wie Matti als fast Zweijähriger stets um sein Wort mit seinem größeren Bruder ringte, hörte und schaute ihnen einfach nur zu. Herrlich, traumhaft. Der Call an sich dauerte nicht lange, aber er bewegte mich innerlich sehr und unmittelbar danach notierte ich folgende Zeilen in mein Notizbuch: „I bear all the nightmares, the battles and warfares, the panic and despair, the black and the blue. I trade all the nightmares, the battles and warfares, the panic and despair for this morning view.“
Ich nahm unmittelbar danach meine frisch in LA erworbene Telecaster in die Hand und begann halbverschlafen zu diesen Worten ein paar Akkorde zu spielen. Und daraus entstand dann am Vormittag im Pyjama im Bett mein Song „Morning View“. Ich schrieb noch ein paar Verse mit seltsamen, ja skurrilen Szenarien und Bildern dazu. Harmonisch spielte ich mich mit permanenten Wechseln zwischen Dur und Moll und es ging sich wunderbar schlüssig für mich und den Song aus. Als ich den Song fertig hatte, nahm ich wie immer ein Memo auf - damals am Macbook, glaub ich. Wenn ich dieses Songmemo heute hier und jetzt höre, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ich erspare es euch aber nun aufgrund der miesen Audioqualität und vielen Fehler. Ich liebe Songmemos, wirklich - wenn auch noch so unfertig und grottenschlecht, aber teilen möchte ich sie nicht.
Ein paar Tage später hatte ich die Möglichkeit, mit dem Produzenten Danny Kalb und dem Drummer meiner geliebten Band The Eels, Jonathan Butch Norton, in einem Studio in North Hollywood (der Name will mir gerade partout nicht einfallen) aufzunehmen. Ich hatte einige neue Songs als Layouts, ja Playalongs vorproduziert und spielte diese Danny und Butch im Studio vor. Bei „Morning View“ sagten beide sofort „Oh yes!“ Und so begannen wir die Aufnahmen mit diesem Song.
Butch hatte wie auch schon ein Jahr davor im Eastwest Studio in seinem schäbigen Chevrolet Van mehrere Vintage-Drumsets und viel anderes Percussion Zeugs mit, entschied sich aber dann dafür, das Ludwig Studio Drumset vorort, außer Snare und Becken, zu verwenden. Nach ein paar Takes hatten wir seine Drums im Kasten und gingen weiter zur nächsten Nummer.
Großartig war damals auch die Erfahrung, mit einem amerikanischen Produzenten auch E-Gitarren aufzunehmen. Ich hatte selbst meine Telecaster und Jazzmaster vor Ort und mietete mir beim Gitarrentechniker von u.a. John Mayer einen Marshall JCM800, ident mit meinem zuhause im Wiener United Indies Studio . Im Studio in North Hollywood hatten wir noch mehrere alte Amps zur Verfügung, aber ich entschied mich als Ergänzung zum Marshall noch für einen Fender „Vibro-king“ - einem kleinen 50 oder 60 Watt „Bassman“ Combo mit eingebautem Tremolo aus den Sechzigern. Zu meiner Überraschung drehte Danny bei beiden Gitarrenverstärkern immer alles nach rechts - beim JCM800, den ich ja von vielen Gigs und aus dem Studio daheim kannte, legte ich mein Veto ein und stellte ihn so ein, wie ich ihn bis dato kannte. Beim Vibro-king ließ ich ihm freie Hand und so durfte ich erfahren, wie so ein kleiner Amp klingt, wenn er komplett aufgedreht wird. Hallelujah! Da der Amp sooo unfassbar laut war bot mir Danny an, eine kleine Kapsel, ja Pille zu nehmen, die er von Butch Vig, seines Zeichens Producer und Recorder von unzähligen Rockalben wie zum Beispiel Nirvana „Nevermind“ bei gemeinsamen Aufnahmen mal bekommen hat. Diese Pillen waren für die Männer in der US Army entwickelt worden und sollten gegen Gehörsturz durch Granaten helfen. Ich nahm sie nicht, er schon. Die Aufnahmen mit dem ums Überleben schreienden alten Amp und meiner Jazzmaster werde ich lautstärkentechnisch wohl niemals vergessen können.
Auf der Aufnahme von „Morning View“, erschienen 2013 auf meiner „LVOE - 13 Months, 13 Songs“ Songsammlung, ja meinem bereits vierten Solo-Album, kann man den lauten Amp gleich zu Beginn ganz gut hören. Ich konnte die Gitarre kaum spielen ohne dass es Feedback gab. Danach war ich so derrisch, ja ohrenbetäubt, wie seither wohl nicht mehr.
Was man an der veröffentlichten Version des Songs allerdings nicht mehr hören kann, sind die damals eingespielten Drums von Butch Norton. Nicht, weil er nicht gut genug performte, sondern weil mein damaliger Live-Drummer in Wien, Alex Pohn, den Song live wie auch im Studio mit noch mehr Energie und einem anderen Feeling versorgte. Wie Alex zu diesem fertigen Playback aus LA im Studio in Wien Schlagzeug spielte, haut mich und viele andere bis heute um. Vielleicht brachte er auch einfach aufgrund seines jüngeren Alters mehr Grunge-Attitude zum Song als der um viele Jahre ältere Butch. Als ich Butch damals mit vollen Hosen anrief und ihm sagte, dass ich bei „Morning View“ seine Drums mit jenen von Alex ersetzte sagte dieser zu mir schlicht: „Hey Axel, you perceive and I deliver. You decide. It’s all good.“ Und er war null sauer oder in seinem Ego verletzt. Wow, dachte ich und lernte durch ihn und seine Haltung als Musiker auch einiges dazu. Respekt, bis heute.
Ich hatte damals, als wir in LA ins Studio gingen wirklich keine Vision davon, wie ich diesen Song produzieren, ja aufnehmen möchte. Danny, selbst Jahrgang 1979 wie ich, nahm den Song als Grunge Track war und führte mich dazu, ihn auch so aufzunehmen. Dass der Song auch ganz ruhig und ohne Lärm funktioniert, zeigte mir ein paar Jahre später auch mein Freund und Weggefährte Martin Rothenender aka Soulitaire oder Ben Martin als er den Song bei mir hier im Studio live an seiner Akustikgitarre performte. Diese Performance gibts übrigens auch auf YouTube unter „Ben Martin - Morning View“ zu sehen und hören. Wunderschön.
Und bevor ich jetzt noch länger herumschreibe hier ein paar Takte von „Morning View“ in meiner Album-Version. In Summer ca. 5 Minuten Grunge à la Axel, quasi Poesie und Lärm vermischt zu einem Song. Viel Vergnügen! Den ganzen Song gibts übrigens überall im Streaming und zum Download, sowie auch am Album als Limited Edition Digipack CD.
Auch heute hier und jetzt erlebe und pflege ich immer noch ganz bewusst den „Morning View“, ja, den Morgenblick nach dem Aufwachen zu einem neuen Geschenk namens Tag. Es ist und bleibt demnach immer wieder verblüffend, was so ein neuer Tag mit sich bringen kann. Oftmals habe ich Angst vor der Ungewissheit, aber meistens überwiegt die Neugierde auf das Neue und frisch Geschehende. Jeden Morgen sich auch jene Dinge und Lebensaspekte in den Sinn zu rufen, für die man dankbar ist, macht ebenso Sinn.
Heinrich von Handzahm, seines Zeichens ein Hamburger Liederschreiber und Künstler, mit dem ich schon viele seiner Songs gemeinsam als Produzent realisiert habe, arbeitete vor vielen Jahren als Manager für eine große und sehr bekannte Wettfirma und hatte damals zwei Assistentinnen zur Seite, die jeweils frei in seinen Kalender eintragen durften. Seine Erfahrung dazu war sinngemäß: „Jeder Tag war von morgens bis abends durchgetaktet. Alles war perfekt geplant, aber immer kam alles anders.“.
Ja, das Leben ist und bleibt eine tägliche Geschichte. Vielleicht naiv, aber dennoch eine der wertvollsten Erkenntnisse bisher in meinem Leben: Jeden Morgen bewusst wahrzunehmen ist ein Moment der Stille und des puren Seins. Und es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Die Lebenspyramide
Nach meinem spontanen, ja faschingsbedingten Ausflug in die Welt der „Rollenspiele im Theater Leben“ letzte Woche und meiner, für viele offensichtlich als sehr witzig empfundenen Pornostar Geschichte an der nächtlichen Supermarktkassa in Los Angeles vor ein paar Jährchen, möchte ich mich heute mal wieder einem ernsteren und schöneren Thema des Daseins widmen.
Und hier kommt mir sogleich und passend zu meinem heutigen Kurzreferat der Titel des Bestsellers „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?“ von Richard David Precht, seines Zeichens ein von mir sehr geschätzter Deutscher Philosoph und Publizist, in den Sinn. Ich höre auch seit Wochen gerne seinen Podcast gemeinsam mit dem Deutschen Journalisten und Talkshow-Host Markus Lanz. Irgendwie mag ich die beiden - jeder auf seine Art und Weise doch skurril, aber auch immer wieder amüsant und vor allem interessant. Die beiden haben schon ein beachtliches Wissen und können ihre Gedanken und Meinungen auch sehr eloquent und spannend ausführen. Ich teile natürlich nicht alle Betrachtungsweisen und Ausführungen der beiden zu den unterschiedlichsten Themen der Gegenwart, aber ich höre ihnen gerne zu und mache mir gerne währenddessen und auch danach mein eigenes Bild - egal ob gerade in der Badewanne oder im Auto oder spazierend im Wald. Ich habe und pflege auch selber gerne gute, ja langjährige Männerfreundschaften - die beiden dürften sich auch privat ganz gut verstehen und dies empfinde ich, gerade in von permanenten äußeren Störgeräuschen und Bedrohungen geprägten und exorbitant fordernden Zeiten, als sehr wertvoll. Ein kurzes, liebevolles „Servas!“ an TommiLee an dieser Stelle. Vielleicht werde ich in den kommenden Wochen und Monaten im Rahmen meines ROMANTICK Podcasts auch mal ein paar Zweier-Gespräche mit dem einen oder anderen meiner besten Freunde und Weggefährten, allesamt berührende und interessante Lebensmenschen, hier führen, mal sehen, es wäre jedenfalls schön.
Aber nun zu meinem Thema von heute: Die Lebenspyramide. „Was ist das jetzt wieder?“, möget ihr vielleicht nun denken. Ich habe bekanntlich nicht Psychologie oder Philosophie studiert, sondern vor mehr als zwanzig Jahren Theater-, Politik- und Medienwissenschaften in Wien und vor der Halbzeit - wie schon mal geschildert - wegen eines lukrativen Jobangebotes in der damals sogenannten New Economy abgebrochen, aber ich beschäftige mich zeitlebens aus Eigeninteresse und der für mich typischen Neugierde für diese Themenbereiche und Geisteswissenschaften. Ich habe selbst aufgrund meiner lieben Freundin D. und familiären Ahnengeschichte (siehe dazu die Ausgabe 12 vom 17. Jänner 2023) jahrelange Psychotherapie und zahllose Gespräche mit diversen TherapeutInnen und spirituellen Lehrern erlebt und manchmal auch einfach so über mich ergehen lassen. All meine Erfahrungen und Erlebnisse damit kann man auch in meiner Musik immer wieder finden.
Die Inspirations-Basis für meine heutige Geschichte bilden im Wesentlichen zwei Komponenten: Einerseits mein Song „You Have Come So Far“ von meinem „MA’AN“ Album aus dem Jahr 2015 (vor ein paar Tagen zufällig mal wieder gehört) und andererseits, unser vor zwei Tagen geführtes Vater-Mutter-Sohn Gespräch mit meinem ersten Sohnemann und Musikus Laurin Finn und meiner Lebenspartnerin Athena. Ja, so unmittelbar entscheide ich, worüber ich für meinem Podcast schreibe und spreche.
Zuerst ein paar Gedanken und Worte zum besagten Opener meines ersten, hier im damals neugebauten „Green Meadow Road Studio“ , gemeinsam mit dem mittlerweile international durch Erfolge mit Acts wie James Arthur oder Florence & The Machine oder Jamiroquai sehr erfolgreichen und liebenswerten Produzenten Alex Beitzke aufgenommenen Albums. Da es sich bekanntlich nicht als sinnvoll erweist, über Musik zu sprechen, spiele ich euch nun besser einfach ein paar Takte von „You Have Come So Far“ vor.
Ja, „You Have Come So Far“ ist kein typisch einfacher, eingängiger, ja durch Beatles und Grunge geprägter Axel Wolph Song wie viele andere. Es handelt sich hierbei eher um ein selbsterfahrenes Mantra in einem Song verpackt. Ein Musikstück, welches sich um einen einfachen Satz dreht, daran klebt und damit lebt. Kein großer Refrain, kein klassischer Songaufbau, keine großen Verse. Kein Songwriter Lyrics Erguss, de facto. Einfach nur ein paar Zeilen, ein Gedanke, ein paar Worte und eigentlich sehr monotone Musik dazu. Alles Musikalische rundherum haben wir dazu gebastelt und aufgenommen, damals hier im neuen Studio, im ehemaligen Schuppen des 1757er Landhauses meiner Kindheit und Jugend. Die Tatsache, dass mein Großvater vor einigen Jahrzehnten hier in diesen Räumlichkeiten Boote zum Wasserski fahren auf der Donau baute, berührt mich bis heute. Das erste aus Mahagoni gefertigte Speedboot hieß „Mücke“, das zweite „Floh“. Ich habe meine Mutter leider niemals auf der Donau Wasserski fahren gesehen - mir wurde aber erzählt, dass sie die Beste am Monoski zwischen Passau und Linz war - und eben hinten dran, am Seil befestigt an den selbstgebauten, von Herstellern wie Riva und Boesch inspirierten Booten von Opa Fred Nening. Aber dies wäre jetzt eine ganz andere Geschichte. Weiter im Text von heute.
Hinter diesem Titel, ja Mantra und Song steht ein wunderschönes Gefühl: Das Gefühl der Ankunft und Dankbarkeit. Die Erkenntnis, schon viel erledigt und geschafft zu haben. Unglaublich viele tägliche Herausforderungen liegen hinter einem. Aus eigenen Händen der Mensch zu sein, der man heute hier und jetzt ist, ist per se großartig. Eine verbale wie musikalische Momentaufnahme. Ein Dankeschön an die eigene Ausdauer, den eigenen Willen und das eigene Streben, Erleben und Leben. Dein, mein und unser Dasein im Jetzt, in diesem Moment hat ein „You Have Come So Far“ verdient. Und ein „It’s good to have you here.“ Und dies de facto eigentlich immer. Immer, wenn man bereit ist, dies auch zu sehen, zu erkennen und auch zu fühlen. Im Idealfall täglich. Und obwohl ich mir dessen bewusst bin und es selbst ja auch geschrieben und realisiert habe, fällt es mir immer wieder schwer. Dies gehört zum Menschsein wohl dazu.
Heute hätte ich gerne auch ein Video von den Aufnahmen damals mit Alex hier im Studio. Ein Musikvideo hatte ich damals auch im Sinn, gibts aber leider auch nicht. Ich hab den Song einmal live für die „One Take Sessions“ der Linzer Filmfirma „Crisp & Juicy“ performt - sie haben es aber leider niemals veröffentlicht oder mir gar gezeigt. Wurscht - war ich wohl mal wieder nicht gut genug für die Welt da draußen, gemessen an irgendwem, damals am Feurich Piano in der ehemaligen Linzer Postgarage. Damit kann ich leben.
Nun gut. „You Have Come So Far“ ist für mich ein Ergebnis einer sogenannten Lebenspyramide. Am Anfang, also an der unteren Basis dieser Pyramide, steht man immer im Jetzt. Heute und hier. In diesem Moment. Ergo: Wer bin ich hier und jetzt? Was kann ich? Was taugt mir? Wie fühle ich mich? Was sind meine Skills, ja Fähigkeiten? Was zeichnet mich aus? Was kann ich vielleicht besser als andere? Oder neutraler betrachtet ohne den anderen: Was kann ich gut? Was erfüllt mich mit Phreude? Wofür brenne ich?
In der mittleren, zweiten Ebene darüber stehen die Fragen: Was kann ich tun? Was fehlt mir? Welche Ausbildung, welche Erfahrung, ja welches Wissen, welche Skills fehlen mir? Welches Tun? Ja, auch, welches Umfeld, welche Hilfsmittel und Instrumentarien und Werkzeuge brauche ich? Welche Menschen, die mir helfen könnten?
Und in der dritten, obersten Ebene, ja dem Gipfel deiner Selbst, diesem kleinen, aber feinen Dreieck (ja, ich weiß, eine Pyramide ist dreidimensional - dazu noch später) steht dein Wunschbild von dir selbst, möglichst präzise und mit Hingabe definiert. Also Antworten auf Fragen wie: Wer möchte ich sein? Was möchte ich durch mich und meine Fügung erreichen? Was ist mein ideales Selbstbild? Wie kleide ich mich? Wie mache ich genau was ich möchte? Wen möchte ich erreichen? Wie fühlt es sich für mich da oben in meinem idealen Selbstbild für mich an? Wie bin ich als Mensch da oben? Wie verhalte ich mich? Wie möchte ich sein?
Nun gut, Träume haben de facto keine Grenzen, außer jene, die man sich selbst auferlegt oder von Eltern und/oder Ahnen mitbekommen hat. Hierzu kann auch die Wissenschaft der Epigenetik einiges erzählen. Dazu irgendwann man mal mehr hier vielleicht - interessiert mich auch derzeit. Ganz oben im kleinen Dreieck meiner Lebenspyramide jedenfalls, darf man träumen und sein, wer man sein möchte. Genau dies bedeutet Leben, ja täglich leben für mich. Und einen Satz unbekannter Quelle find ich hierzu auch sinnbringend: Be careful what you wish for, it might come true.
Und warum nenne ich es jetzt „Lebenspyramide“ und nicht „Lebensdreieck“? Ganz einfach deshalb, weil unser Dasein und Leben, ja Erleben immer ein mindestens dreidimensionales Ganzes ergibt. Es passiert einfach alles immer täglich und bringt neue Herausforderungen, ja Challanges mit sich. Eindimensional geht gar nichts.
Und unsrem Großen, ja Musikus und wunderbaren Menschen Laurin hat dieses Pyramidenspiel sicher auch geholfen. Wir sind dran, tagtäglich, gemeinsam. Wir, hier in meiner Familie. Du, in deiner und für dich hoffentlich auch. Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Rollenspiele im Theater Leben
Heute ist also Faschingsdienstag. Juhu. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mir der Fasching immer schon am A….. vorbei ging. Schon als Kind war es mir immer zu blöd, mich zu verkleiden - ja, ich hatte schon als kleiner Romanticker damals keine Lust bei derartigen Massenphänomenen mit dabei zu sein. Irgendwer sagt „Heute ist Fasching, heute dürfen wir uns verkleiden!“ und alle tun es. Widerlich, lächerlich. Aber so unterschiedlich sind eben die Geschmäcker.
Da heute in unsrem kleinen Ort hier an der Donau ein riesiger Faschingsumzug stattfand, herrschte den ganzen Tag lang Chaos. Also nicht in unserer Straße, aber überall rundherum. Wir wurden verschont und ich konnte ein paar Augenblicke in der frühlingshaften Sonne verbringen. Man riecht den Frühling - dieser Duft tut der von Winter und Covid und dem Arschgesicht Februar angeschlagenen Seele gut und macht Hoffnung, dass es schon bald wieder woam werdn wird. Hier sagt man übrigens „jetzt gspiat ma scho in Tog“ und meint damit, dass die Tage wieder länger werden. Im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, sagt man das auch. Schön.
Ich hab heute während meiner kleinen Motorradrunde mit unserem Mini Cooper (die Mopeds stehen noch in der Garage) demnach die schrägsten Gestalten und Kostüme gesehen - schon beachtlich wofür so manche diesen ach so witzigen Verkleidungstag verwenden, ja missbrauchen. Und parallel dazu wird die Debatte geführt, ob man sich als weißer Mitteleuropäer überhaupt noch fremdes Kulturgut aneignen darf, sprich sich als Indianer oder Cowboy überhaupt noch verkleiden darf. Unglaublich, wie absurd das Ganze. Ich sah viele Schneemänner, Männer als Frauen, Frauen als Männer, Frauen als Polizisten, Polizisten als Polizisten, Sparmarkt KassiererInnen als Erdbeeren, viele Cowboys und Indianer, ein paar Gabaliers und ja, auch manche Bänker. Geil, dachte ich, welch schauderhaftes Leben muss man wohl führen, um im Fasching dann als Bänker zu gehen. Hallelujah.
Ich habe mir heute also meine weißen langen Haare auf einen Dutt zusammengebunden und bin in der Rolle eines hippen, urbanen Landeimittvierzigers und schwarze Hornbrille Trägers im hippen urbanen Engländer mit Bayrischem Dreizylinderherz herumgecruist. Und da musste ich u.a. auch an eine Situation an einem Faschingsdienstag vor ein paar Jahren hier im kleinen Markt an der Donau, damals noch als ziemlich frischer Rückkehrer aus den Metropolen Los Angeles und Wien, denken. Damals holte ich meinen mittleren Sohn Matti von der Volksschule ab. Am Weg dorthin im hippen schwarzen, bayrischen Familienkombi hielten mich vorm Friedhof zwei Polizisten auf. „Fahrzeugkontrolle, Führerschein und Zulassung, bitte.“ Gesagt, getan. Am Vortag hatte ich mit meiner Herzensdame Athena ein Studio-Musikhören-Sitin und mit Sicherheit ein paar Biere getrunken. Am Morgen war ich jedoch schon laufen gewesen und somit hoffte ich, dass der von beiden Beamten eingeforderte Alkotest, eingeleitet mit den Worten „Habens eh sicher scho amoi blosn, oda?“, keine negativen Überraschungen mit sich bringt. Ich hatte tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt noch nie blasen müssen, um bei dieser fragwürdigen Wortwahl zu bleiben. Ja, ich war jungfräulicher Alkobläser und so stellte ich mich auch irgendwie an. Egal, das Ergebnis war zu meinem Erstaunen 0,0 Promille und sie ließen mich wieder weiterfahren, alles paletti und streberhaft in Ordnung. Nur ein paar Meter später dachte ich, „Jetzt hast du DIE große Chance verpasst, den beiden Typen einfach für die gut gelungene und sehr authentisch wirkende Verkleidung zu gratulieren und einfach weiter zu fahren.“ Das wärs gewesen - einfach kurz stehenbleiben vor den beiden Autoritätsjüngern, Fenster runter und so was wie „Hey Burschen, schaut echt echt aus, gratuliere!“ und einfach weiterfahren. Tja, ich war zu langsam im Denken und zu unmutig und geschwächt vom Vortag. Weiter im heutigen Text - der mich noch was weiß ich wohin führen wird. Ich habe heute überhaupt keine Lust zu schreiben und mich de facto selbst ins Studio getreten. Auch gestern gab es seit längerem mal wieder ein Studio-Musikhören-Sitin und mein Kopf gleicht eher noch einer fauligen Matschbirne als einem Rechenzentrum eines exhippen Pseudointellektuellen.
Als Kind ging ich jedenfalls immer als Indianer zum Fasching. Ohne schlechtem Gewissen irgendeiner Minderheit nicht den nötigen Respekt zu zollen. Lächerlich. Ich lebe in meinem Leben schon genug Rollenspiele Tag ein und Tag aus. Ich bin Vater, Lebenspartner, Freund, Songwriter, Komponist, Produzent, Tennisspieler, Tennislehrer, Motorradfahrer, Medienkünstler, Gärtner, Maler, Podcaster, Schriftsteller, etc., ich wüsste ehrlich gestanden nicht einmal in welche Rolle ich am Faschingsdienstag schlüpfen möchte. Wenn, dann eher was Mutigeres, denke ich, irgendwas zu mir als notorischer Romanticker richtig gut Passendes und leicht Abschreckendes - als Pornostar, zum Bespiel. Wie damals in Los Angeles an der mitternächtlichen Supermarktkassa. „Was war denn da?“ denkst du jetzt vielleicht. Tja, eine schöne Geschichte aus meiner Vergangenheit kommt mir da gerade in den Sinn und passt auch ganz gut zum anscheinend heutigen Thema meiner sechszehnten Podcast Ausgabe namens „Rollenspiele im Theater Leben“. Schöner Titel.
Damals fuhr ich kurz vor Mitternacht mit meinem PT Cruiser in LA noch zum Supermarkt. Ich hatte den ganzen Tag geschrieben und an Songlayouts für bevorstehende Studioaufnahmen gearbeitet und verspürte die Lust auf Bier. Meine Landlady Nina, ihres Zeichen Photographin in der Stadt der verlorenen Engel, hatte ebenso Lust auf Alkohol und so nahm ich ihre Rotwein-Bestellung entgegen und begab mich rasend zum nahe gelegenen Vons Supermarket. Praktisch für Süchtlinge und/oder Nachteulen jedweder Art ist es in Los Angeles, dass Supermärkte rund um die Uhr geöffnet haben. Manchmal echt creepy, wenn man um Mitternacht oder später in einen riesigen, meist menschenleeren Supermarkt geht, aber so ist es eben und man nimmt an, was man haben kann. In den Wochen davor fiel mir in diesem Riesengreißler eine schwarze oder besser gesagt afroamerikanische Angestellte mit extrem lauter Stimme und der Statur einer typischen „Big Mama“ auf. Auch ihr Drang nach Smalltalk mit jeder und jedem fiel mir unangenehm auf, da ich es wahrlich nicht ausstehen kann, wenn man immer und überall mit jedem über irgendwas Belangloses sprechen muss. No, I am not a smalltalk guy. Eine Offenbarung. An diesem Abend war sie die einzige, die noch Dienst hatte. Ich holte mir ein Bier, irgendwelche Cracker dazu und für Nina eine Flasche Rotwein und ging zur Kassa. Dort wartete Big Mama schon auf mich - und ein paar Kunden. Genauso wie ich Smalltalk liebe, liebe ich es auch mich an einer Supermarktkassa anstellen zu müssen - habe ich doch schon seit vielen Jahren das fertige Konzept für das drahtlose Selbstbezahlen im Supermarkt in der Schublade. Auch hierzulande halte ich es kaum aus, wenn zehn Menschen vor mir an der Kassa sind und dann auch noch die Kupfermünzen im Portmonnaie zusammenkratzen, oft begleitet von den Worten „So, passts jetzt?“. Ich könnte durchdrehen. Oder laut fluchen wie im Auto, wenn mal wieder jemand hinterm Lenkrad eingepennt ist. Seit ich den von mir - Achtung an die Esoterikpolizei da draußen, jetzt könnte es für euch unausstehlich werden - ja, den von mir sehr geschätzten Eckhart Tolle kenne, übe ich mich in Stille und dem Annehmen des Momentes, wenn ich an der Kassa von MitbürgerInnen in meinem Flow aufgehalten werde. Ich versuche nichts zu sagen und fluche maximal nur nach innen.
Weiter im Text. Damals kam ich also an die Kassa. Vor mir ca. sieben Personen mit ihren Einkäufen. Mit jeder und jedem startete die Dame mit dem Megaorgan einen für alle hörbaren Smalltalk, während sie die Lebensmittel und Spirituosen über den Strichcodescanner zog. Ich langweilte mich zu Tode und fürchtete mich zugleich schon vor meiner Zwangsbegegnung mit ihr. Eines muss ich vorweg auch noch erwähnen - und zwar mein damaliges Aussehen und Auftreten: Ich trug eine grauweißschwarz gemusterte Hose, dazu ein schlichtes Sakko, einen Tweedhut, eine riesige weiße Plastik-70s-Designerbrille, einen Porno-Kipferlbart und dazu meist noch ein schlichtes oder auch auffälliges Hemd. Ja, so fühlte ich mich damals in meiner Künstlerhaut wohl. Ich wollte, wie bekanntlich wir alle, gesehen und im besten Falle auch geliebt werden. Heute trage ich meistens schwarze, schlichte Kleidung und nur mehr bunte Socken und manchmal bunte Unterhosen - so viel Ehrlichkeit muss schon sein.
Plötzlich, es standen in etwa zehn weitere Kundschaften hinter mir, kam ich an die Reihe. Die Big Mama Kassadame starrte mich zuerst theatralisch an, um mit den Worten „Show me your ID, please!“ aufgrund der am Förderband liegenden Alkoholika fortzufahren. Ich gab ihr meinen rosafarbenen Österreichischen Führerschein - noch einen alten. Also einer der Generation rosa Fetzen, gemacht aus einer Mischung aus Stoff und Papier, meistens leicht bis stark zerfleddert und wie in meinem Falle einem Photo eines achtzehnjährigen jungen Mannes mit langen, blondierten Haaren. Die Dame nahm den Führerschein mit den lauten Worten „Oh my god, what’s that!?“ entgegen. Dann schwieg sie für ein paar Augenblicke, während sie meinen Führerschein aufmerksam begutachtete und offensichtlich auch zu lesen versuchte. Dass sie damit den Betrieb an der Kassa noch weiter bremste, war ihr offensichtlich scheiß egal. Ganz im Gegenteil. Wie aus dem Nichts sagte sie dann mit voller Stimme coram publico die folgenden Worte: „You are a porn star right?! That’s why I know you!“ Sie starrte mich an, ich starrte wortlos und perplex, ja gelähmt wie nach nem Stromstoß zurück. Die Leute hinter und neben mir starrten mich auch an. Manche fühlten sich sogleich auch an mich als Pornostar erinnert. Ich dachte nur „Das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt - Mama hilf mir bitte.“ Dann stammelte ich in die Stille die Worte „No, I am a singer-songwriter and musician…“ Sie beugte sich über das Förderband, legte dabei ihre Riesenbrüste auf meine Bierdosen, schlug mir kumpelhaft an die Schulter, wie es sonst nur mein Vater macht, wenn er mir was erzählen möchte und sagte „Just kiddin’, boy. Was a good one, ha?“ Ich lachte mit ihr und allen rundherum - ach, wie witzig. Ach wie hatten wir es alle lustig auf meine Kosten. Heute kann ich auch schon drüber lachen, aber damals dachte ich echt, ich bin im falschen Pornofilm.
Was lernen wir daraus? Natürlich nicht wirklich fiel. Außer, dass man die eigene Rolle auch noch so gut mit Äußerlichkeiten herauszeichnen und betonen kann - was jemand gegenüber dann für sich annimmt und daraus schließt, ist immer eine andere Frage. Mein spiritueller Lehrer Alexander damals in Wien sagte immer so schön, „Was jemand von dir denkt, geht dich nichts an - es ist ihre oder seine Privatsphäre.“ und dem stimme ich bis heute zu.
Wie viele unterschiedliche Rollen ein so ein Leben mit sich bringen kann, ist schon beachtlich. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, zwischen den einzelnen Rollen zu switchen. Manchmal, wenn ich mit Tennis- oder Motorradkleidung am Klavier sitze und spontan irgendwas spiele oder schreibe, komme ich mir schon etwas seltsam vor. Aber vielleicht sind es ja auch genau diese persönlichen Vermischungen, die einen zu einem interessanten und/oder liebenswerten Menschen machen können. Keine Ahnung.
Ich werde mir wohl das nächste Mal, wenn ich an irgendeiner Supermarktkassa aufgehalten werde, die nötigen Gedanken dazu machen. Oder auch nicht. Egal in welcher Rolle man sich gerade selbst wahrnimmt oder vorm Spiegel sieht: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Alles aus dem Nichts.
Heute, an diesem kalten, nebeligen und bei mir durch meine Post Covid Lethargie sich etwas düster darstellenden Valendienstag, möchte ich meine wöchentlichen Kurzreferate thematisch ein paar Schritte in Richtung meines Daseins und Schaffens als Singer-Songwriter, Liedermacher und Komponist sowie auch Musikproduzent bringen. Ich beginne mit zwei mir schon sehr oft gestellten Fragen, sei es in Interviews oder aber auch nach Konzerten oder von Freunden und meinem Umfeld:
1. Wie und warum schreibst du Songs? Und 2. Wie kannst du so viel Persönliches so direkt und unverblümt von dir preisgeben und mit der Außenwelt teilen?
Nun gut, immer der Reihe nach. Zuerst mit einem wunderbaren Zitat von dem von mir sehr geschätzten Brian Eno aus dem sehenswerten Dokumentarfilm „Here Is What Is“ von und mit Daniel Lanois. Beide ihres Zeichens sogenannte Weltkünstler im Bereich der Musik und Musikproduktion:
„Beautiful things grow out of shit. Nobody ever believes that. Everyone thinks that Beethoven had his string quartets completely in his head—they somehow appeared there and formed in his head—and all he had to do was write them down and they would be manifest to the world. But what I think is so interesting, and would really be a lesson that everybody should learn, is that things come out of nothing. Things evolve out of nothing. You know, the tiniest seed in the right situation turns into the most beautiful forest. And then the most promising seed in the wrong situation turns into nothing. I think this would be important for people to understand, because it gives people confidence in their own lives to know that’s how things work.
If you walk around with the idea that there are some people who are so gifted—they have these wonderful things in their head, but you’re not one of them, you’re just sort of a normal person, you could never do anything like that—then you live a different kind of life. You could have another kind of life where you could say, well, I know that things come from nothing very much, start from unpromising beginnings, and I’m an unpromising beginning, and I could start something.“
Diese wunderbaren Zeilen sprechen mir zur Gänze aus der Seele und beschreiben auch ganz gut den Prozess des Schreibens. Als ich mit 14 Jahren zum Songs schreiben begann, hatte ich keine Sekunde darüber nachgedacht, wie und warum ich mich hinsetze und zu den einfachsten Gitarrenakkorden sich reimende, englische Wortfetzen in mein Notizbuch notiere. Ich war unglücklich verliebt, die Pubertät begann und voller Emotionen, die ich entweder am Tennisplatz oder eben mit einer Gitarre am Schoß ans Tageslicht bringen wollte. Mir war auch völlig egal, ob meine ersten kreativen Ergüsse qualitativ von Wert waren. Ich liebte schlicht den Prozess des Erschaffens - dieses Gefühl aus dem Nichts etwas Erlebbares geschaffen, ja realisiert zu haben. Diese ersten Songs dann mit meiner Teenage Grunge Punkband namens „Mindcure“ im Trio zu spielen war einfach ein großartiges Erlebnis und erfüllte mich mit riesiger Freude und ja, Spaß. Musik ist bis heute für mich einfach etwas Übermenschliches geblieben. Durch das Schreiben oder Spielen eines Instrumentes bekommt man Zugang zur wundervollen Welt der Musik, ja, Zutritt ins Reich dieser universellen Sprache.
Ich hatte damals nie Zweifel daran, dass ich auch so gute Songs schreiben könnte wie jene Menschen, die mich mit ihren Songs, ihrer Musik bewegten. Egal, ob es nun Beethovens Klavierstücke als junger Klavierschüler oder die Beatles Platten meines Vaters oder etwas später Grunge Songs à la Nirvana waren, völlig egal. Musik bewegte mich und ich fühlte mich als einer von denen. Als einer jener Menschen, die Musik generieren und mit der Welt da draußen offenherzig teilen. Ich empfand es nie als zwei Welten - ich fühlte mich nie als Songwriter oder Mensch zweiter Klasse. Lennon schrieb Songs, Cobain schrieb Songs, Costello schrieb Songs,…sie alle schrieben Songs und ich eben auch. Dies mag aus heutiger, erwachsener Sicht naiv und auch auf eine gewisse Art und Weise arrogant wirken. Es war weder noch: Mein Gefühl war genau richtig. Nur weil ich kein Weltstar gemessen an Reichweite oder Following oder Millionen am Konto geworden bin, heißt es noch lange nicht, dass ich nicht einer von ihnen bin. In einer Selbsthilfegruppe von anonymen Songwritern würde ich mit geschwellter Brust nun aufstehen und coram publico „Ich heiße Axel und ich bin Songwriter!“ sagen.
Somit zur Frage 1: Wie und warum schreibst du Songs? Die Antwort auf diese Frage habe ich über die letzten zwanzig Jahre schon ganz gut üben dürfen. Ich schreibe de facto eigentlich immer. Jeden Tag sammle ich Gedanken, Gefühle, Wortfetzen, Ideen, Harmonien, Eindrücke, was auch immer. Ich sauge mein Leben und Erleben auf, wie ein Schwamm. Ich bin demnach ein Jäger und Sammler was Puzzlestücke für Musik angeht. Mein iPhone ist voll mit Instrumentalideen am Klavier und an der Gitarre. Beinahe jedes Mal, wenn ich spiele, nehme ich irgendeine Idee oder gleich mehrere am iPhone auf. Wenn dieses deppate Kastl schon einen Sinn haben mag - für mich jedenfalls diesen. Früher am Kassettendeck meines Sony Ghettoblasters, dann auf meinem portablen Minidisc Recorder, dann am mobilen Tascam Aufnahmegerät und schließlich auf meinen iPhones. Und deshalb arbeite ich im Entstehungsprozess auch niemals mit Noten - auch dies werde ich oft gefragt. Ja, ich habe als Kind Noten lesen und schreiben gelernt - ich lernte ja Klavier von fünf bis zwölf. Um mir Ideen zu merken oder um zu komponieren, verwende ich allerdings nie die Notenschrift.
All diese Puzzlesteine gedeihen und arbeiten in mir bis zum Zeitpunkt x auf der Zeitachse, wo ich dann wieder bei einem Instrument sitze und aus den vielen Mosaiksteinchen ein Ganzes forme. Dieser Prozess ist schlicht großartig und die absolute Erfüllung für mich. Dieser Prozess ist vor allem dann so erfüllend, wenn ich keine störenden Gedanken wie „Ist das gut genug?“ oder dergleichen zulasse. Wenn es mir gelingt, mich einzig und alleine auf mein Gefühl, meine Intuition zu verlassen, dann kommt auch immer was Schönes, Brauchbares, Sinnbringendes dabei raus.
Über die Jahre ist mir natürlich klar geworden, dass man Musik auch anders, vielleicht auch kommerziell viel erfolgreicher kreieren könnte. Viele meiner Kollegen arbeiten mittlerweile ganz anders. Man trifft sich in sogenannten Songwriting-Camps - meistens von irgendwelchen Musikverlagen organisiert - um gemeinsam Songs für bekannte InterpretInnen oder auch schlicht für sich selbst zu schreiben. Viele Hits sind so natürlich schon entstanden. Mich hat so etwas niemals interessiert. Dies heißt nicht, dass ich nicht auch mit anderen Musik schreiben könnte - der alleinige, solo mio Prozess aus dem Nichts etwas zu erschaffen, bedeutet mir aber unvergleichlich mehr. Dass man sich so weder nach Trends oder erfolgsversprechenden Konzepten orientiert ist naheliegend, der kleinere bis hin zu fehlende kommerzielle Erfolg oftmals vorprogrammiert.
Wenn dann doch immer wieder einzelne Songs sogar in rein kommerziell orientierten sogenannten Formatradios laufen oder in diversen Charts auch große, namhafte Produktionen und Namen hinter sich lassen, überrascht dies natürlich immer wieder positiv und bringt auch Freude mit sich. So geschehen zum Beispiel mit meinen „Wedding Songs“ von 2007 in den USA sowie mit einem meiner ersten Songs in meiner Muttersprache „Vorüber gehen“ im hiesigen Hitradio Ö3 letztes Jahr. Egal.
Wunderschön ist es in den letzten Jahren für mich auch immer wieder, wenn ich mich im Haus oder in meinem Studio einfach zu einem Klavier setze und völlig frei drauf los spiele. Ohne Plan, ohne Idee, ohne über Wochen und Monate gesammelter Mosaiksteinchen im Kopf. Einfach spielen, wonach mir gerade ist. Diese Sammlung von Klavierstücken mit dem Titel „Piano, piano“ möchte ich vielleicht sogar heuer noch mit euch teilen. Drei Stücke mit den Titeln „Donau“, „Ewigkeit“ und „Quelle“ (alle feat. Florian Eggner am Cello) habe ich bereits veröffentlicht - diese gibt es überall im Streaming oder aber auch auf meiner Website sowie auch auf YouTube als Videos.
Frage 1 ist somit, denke ich, beantwortet. Man könnte jetzt natürlich noch weiter ins Detail gehen, dazu hab ich aber gerade keine Lust. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt x auf der Zeitachse.
Sehr oft wurde und werde ich eben auch Frage Nummer 2 von heute gefragt: Wie kannst du so viel Persönliches so direkt und unverblümt von dir preisgeben und mit der Außenwelt teilen? Am liebsten beantworte ich diese Frage immer mit einer kurzen Gegenfrage: „Wie kann man das nicht?“ Klingt auch viel arroganter und abgehobener als ich es meine. Für mich war es seit jungen Jahren immer ganz natürlich, meine Gedanken und Gefühle zu kommunizieren. Wer mich „Wie geht es dir?“ fragt, bekommt eine ehrliche, manchmal auch längere Antwort. Von mir kann man auch erfahren, wie es mir geht, wenn man mich nicht direkt danach fragt. Dies mag für viele verstoßend und unsympathisch sein. Meine Familie und besten Freunde schätzen allerdings diese Seite von mir - vermute und hoffe ich. Ich glaube sagen zu können, dass ich emotional ehrlich bin. In den USA war dies immer sehr amüsant. Die Amis, wie wir hierzulande salopp zu den US Bürgern sagen, reagierten sehr oft verstört, wenn ich die Begrüßungsfloskel „Hi, how’s it going?“ oder „Hey, how are ya?“ Etwas konkreter als erwünscht beantwortete. Aber ich mag dies auch bei anderen Menschen. Gerade auch Künstler, die autobiografisch schreiben, berühren mich und schätze ich sehr. John Lennons Soloalbum „Plastic Ono Band“ haute mich damals als Teenager beinahe um. Damals fragte ich mich auch noch „Wahnsinn, wie kann man so ehrlich sein zu jedem?“. Faszinierend, hervorragend, mutig, großartig. Wenn wir schon das Maul aufmachen, dann wenigstens mit aufrichtigen und ehrlichen Worten. Und gleichzeitig akzeptiere ich mittlerweile - dies war nicht immer so - auch voll und ganz, wenn jemand mit meiner Ehrlichkeit, meiner Musik, meinen autobiografisch geprägten Texten bis hin zu diesem Podcast nichts anfangen kann. Jede und jeder kann mich zu jederzeit einfach wegzappen - wie ein schlechtes Programm im Fernsehen oder auf Mausklick im Internet. Oftmals reagieren gerade Männer so richtig verstört auf meine emotionale Offenheit. Aber: I can deal with it. Mir fehlt die Arroganz zu glauben, dass meine Geschichten, Gedanken und Gefühle irgendjemanden interessieren. Teilen tue ich sie dennoch. Von Herzen gerne. So, wie ich auch weiter Musik schreibe und teile.
Da fällt mir spontan folgendes Lennon Zitat, gestohlen von Oscar Wilde, ein: „Life is what is happening to you, while you are busy making other plans.“ Egal ob Musik oder Texte oder Bücher schreiben: Es geht um den Prozess an sich. Das Ergebnis ist per se uninteressant. Der Moment des Schaffens zählt. Und wenn der Moment ein guter ist, dann kommt auch etwas Schönes dabei raus. Wenn nicht, dann eben nicht. Aber genau diesen Prozess sollte man zulassen. Dies bedarf nicht viel an Mut. Wenn man dabei Scheiße baut, baut man dabei eben Scheiße. Sorry für die Wortwahl. Es gibt de facto keine Angst vorm Scheitern. Die Angst vorm Scheitern ist oftmals nichts als ein großartiger Beweis dafür, dass man kreativ sein kann. Ich finde es immer wieder witzig und schauderhaft zugleich, welch unglaubliche Horrorszenarien in so vielen Köpfen da draußen entwickelt und kreiert werden, oftmals begleitet von den Worten „Ich kann nicht kreativ sein“. Paradox.
Wenn man sich furchtbare Dinge ganz klar vorstellen kann, dann kann man sich auch ganz wundervolle Dinge vorstellen. In der englischen Sprache liegt dieses Faktum noch viel näher beisammen: „Using or abusing your imagination“. Zwei Buchstaben machen den Unterschied. Traumhaft.
Ja, mir ist schon klar, dass nicht jeder Mensch mit der gleichen Vorstellungsgabe von Natur aus ausgestattet wird. Klar, hier gibt es Unterschiede - so, wie wir eben alle unsere genetischen Voraussetzungen, Prägungen und Talente haben. Ich glaube aber schon, dass nahezu jeder Mensch sinnbringend kreativ sein kann. Und genau darum geht es: um den Prozess des kreativen Handelns an sich. Niemals um das Ergebnis oder gar irgendeinen Erfolg damit. Schlicht um das bewusst positiv eingesetzte Vorstellungsvermögen und Handeln damit. „No hell below us, above us only sky.“, schrieb Lennon zutreffend. Die Grenzen beim Träumen setzt man sich nur selbst.
Was am Ende dabei rauskommt, sieht man dann, wenn man fertig ist. So wie auch dieses kleine Kurzreferat von heute. Ich verfolge keinen Plan mit diesem Podcast. Ich habe kein Konzept. Ich habe das Schreiben nicht studiert. Ich schreibe einfach. Ich teile, weil ich das Leben liebe. Ich liebe, weil ich das Teilen lebe. Wenn es manchmal auch noch so holprig läuft und man beinahe in den unzähligen Androhungen und Störgeräuschen von außen zu ersticken droht.
Es gilt die Zeit auch kreativ zu nützen, denn sie ist rar…und Morgen viel früher wieder zu Ende als Gestern noch war.
Die Fieberstille. Ein Kurzbericht über einen mir bisher noch unbekannten Weg zur inneren Stille.
Eigentlich wollte ich heute eine Serie von Aufsätzen zum Thema „Songwriting - Wie, wo und warum schrieb ich diesen Song“ beginnen und damit erste Einblicke in mein über zwanzigjähriges Schaffen als Singer-Songwriter, Komponist und Musikproduzent geben. Doch wie so oft im Leben kam mal wieder alles anders. Trotz meiner dreifachen Corona-Schutzimpfung und einmaligen Genesung letzten April, hatte ich die Ehre nochmals die Qualitäten dieses Chinesischen Wundervirus zu erleben. Diesmal sogar noch in etwas schärferer Gangart als beim Erstversuch. Somit lag ich heute vor einer Woche mit bis zu 41,4 Grad Fieber - ja, ich wusste selbst auch nicht, dass das bei einem Erwachsenen überhaupt geht - in unserem Ehebett. Eigentlich keine riesige Schlafstätte, aber des Öfteren fühlte ich mich an die Worte von Gordon Sumner aka Sting erinnert: „The bed’s too big without you…“, wobei sich das „you“ in diesem Falle an mich selbst richtete. Wo bin ich? Was ist bloß los mit mir? Drei Tage lang kämpfte ich immer wieder mit Fieber-Spitzenwerten über 40 Grad - bis ich endlich mit der Hilfe einer befreundeten Ärztin das richtige Mittel gegen diese absolut unempfehlenswerten Körpertemperaturen gefunden hatte. Wen es interessiert: die Mittel der Stunde waren Ibuprofen und Parkemed, dreimal am Tag. Diese kleinen Wunderpillen - es sei erwähnt, dass ich schönerweise bis jetzt seltenst Schmerzmittel brauchte - ließen mein Fieberschiff aus meterhohen Wellen in ruhigere Gewässer gleiten. Unglaublich welch großen Unterschied es macht, ob man nun läppische 39 oder imposante 41 Grad Fieber hat. Eine neue Erfahrung, aber dazu heute ausnahmsweise etwas später noch mehr. Ich versuche ja am Puls der Zeit zu bleiben und gehe sämtlichen Trends und hippen Sachen immer gleich auf den Grund - natürlich nicht. Scherzal. Ich bin kein urbaner Hipster wie anno dazumal mehr. Bevor ich meine Worte und Gedanken allerdings in Richtung „Fieberstille“ lenke noch kurz ein Update zum Thema der letzten Ausgabe, sprich „Algorithmen“:
Ich habe euch ja vor zwei Wochen ein Kurzreferat zu meinen Erfahrungen mit dem ach so wichtigen Thema unserer Zeit, namens „Following“, ja der selbstgenerierten Reichweite als Künstler, gehalten. Und da ich nach wie vor sehr neugierig bin, habe ich mit dem neuen Video zu meinem ROMANTICK Song „Lieber Februar“ einen neuen Selbstversuch gestartet. Das Video erreichte in den ersten 14 Tagen nach dem Release am 20. Jänner 2023 ohne jeglicher finanzieller Werbe-Unterstützung 142 Menschen. Wow, mager, sehr mager. Vor vier Tagen habe ich nun eine Google Ads Kampagne mit 5€ Tagesbudget in Österreich, Deutschland und der Schweiz gestartet. Gerade eben habe ich die aktuellen Zahlen nach 4 Tagen abgerufen: derzeit stehen wir bei 2164 Videoaufrufen auf YouTube. Mehr als 15mal so viele Aufrufe in vier Tagen mit Werbeunterstützung als in 14 Tagen ohne. Ich denke, dies alleine sagt schon sehr viel aus und zeigt uns abermals, wie der Hase läuft da draußen.
Hier kommt mir eine kleine Geschichte aus meiner Kalifornienzeit spontan in den Sinn. Als ich, ich denke, es war 2007, erstmals in Los Angeles im „The Gig“ auf Melrose Avenue einen Gig spielte, musste ich im Vorfeld die sogenannte „pay for play“ Vorgehensweise kennenlernen. „Was ist das jetzt wieder?“ - ja, das dachte ich mir damals auch. Dies bedeutet, dass man, wenn man in einem Club als Nobody spielen möchte, gerne spielen kann, wenn man dafür bezahlt. Also nicht der Künstler oder wie man im Land der unmöglichen Begrenztheiten gerne sagt, der Act wird vom Veranstalter für seine Darbietung bezahlt, sondern genau umgekehrt. Dies war damals in meiner Zweitheimat Wien tatsächlich noch ganz anders. Entweder bekam man eine Fixgage oder machte sich mit dem Veranstalter einen Tickets-Deal aus, sprich teilte sich die Einnahmen durch den Ticketsverkauf untereinander nach einem vorher vereinbarten Aufteilungsschlüssel auf. In der Stadt der verlorenen Engel, wie man sie vor Ort gerne zutreffend nennt, war und ist dies bis heute eben anders. Meistens muss man dem Veranstalter einfach eine gewisse Anzahl an Tickets vorab abkaufen, um spielen zu dürfen. Das betriebswirtschaftliche Risiko wird demnach zur Gänze dem Act zugeschrieben und übergeben. Und irgendwie erinnert mich dies an die bereits geschilderte Following-Sache, so wie der Musikmanager in London zutreffend meinte: „There is no following right now, so let’s wait.“
Mit diesem Paradigmenwechsel vom ursprünglichen Musikbusiness, wie ich es in meinen Anfangsjahren auch noch kennenlernen durfte, hin zum heutigen „Do It Yourself“ Selbstvermarktungsprinzip habe ich damals wie heute so meine Problemchen. Nicht, weil ich ein konservativer Starrkopf und Früher war alles besser-Denker bin - ganz und gar nicht - sondern, weil ich nach wie vor ein Fan von Professionalität und Berufung bin. Was meine ich damit: Ja, ein Künstler sollte heutzutage - wie auch übrigens damals schon - eine Ahnung davon haben, wie man Musik vermarkten und verkaufen kann. Ich bin aber dennoch der Ansicht und Meinung, dass es auch heute noch immer so wie damals unterschiedliche Rollen in der Musikbranche gibt. Kurz anders gesagt: Die eierlegende Wollmilchsau gibt es de facto nicht. Und wenn es sie erfolgreich gäbe, dann wäre ich wohl selbst ein gutes Beispiel dafür. Ich kann viel und meine dies bescheiden. Ich schrieb bisher ca. 300 Songs und habe über 100 davon bereits veröffentlicht. Ich habe meine Alben meistens selbst im eigenen Studio alleine oder mit Gastmusikern eingespielt, aufgenommen und produziert und die meisten meiner Releases auch selbst gemischt. Auch die Album-Artworks sowie zahlreiche Videos kommen von meinen Apple-Computern. Ja, ich habe mit United Indies auch ein eigenes Plattenlabel und schon vieles veröffentlicht und vermarktet, von Grammatneusiedl bis New York City Radio- und Promokampagnen geschalten und finanziert. Ich erwähne dies alles nicht als Angeber, sondern, weil ich es als Autodidakt einfach so gemacht habe. Manches erfolglos, manches erfolgreicher. Dass meine Alben und Songs in Übersee auf hunderten Radiostationen liefen, war zum Beispiel ein schöner Achtungserfolg. Reich wurde ich an Geld dadurch nicht, aber jedenfalls reich an Erfahrungen und Erlebnissen.
Irgendwann in den letzten zwanzig Jahren, ist das ganze System dann wohl sukzessive gekippt. Meiner Beobachtung nach einhergehend mit dem gratis Erwerb von Musik. Hatte ich noch meine eigene CD- und Plattensammlung in meinem Jugendzimmer und horchte diese von vorne bis nach hinten und von oben bis nach unten tausendfach durch, so haben meine Söhne heutzutage die halbe, wenn nicht mittlerweile sogar ganze Musikgeschichte für einen kleinen monatlichen Beitrag, den der Papa bezahlt, am Smartphone, ja dem künstlich intelligenten Volksempfänger der Jetztzeit.
Die Tantiemen, die man als Urheber, ja Musikschaffender für Plays, ja Einsätze im Online-Streaming bekommt, sind so lächerlichst klein, dass man sich damit auch bei mehreren Tausend Darbietungen noch kein Lego Häuschen ohne Garten und Garage bauen könnte. Im Gegensatz dazu verdienen sich die Content-Provider wie Spotify, Apple, Deezer, YouTube oder wer auch immer, krumm und dämlich. Ja, wir leben im Pay for Play Deluxe Zeitalter. Egal, ob als Act in den unzähligen, aber auch immer weniger werdenden Live-Clubs der Metropolen dieser Welt oder als einer von zahllosen Künstlern mit einem neuen, selbstproduzierten Video auf YouTube: wenn dich wer sehen soll, dann bezahle dafür. Ja, dieses Modell kennt man natürlich aus der klassischen Werbung jahrzehntelang ganz gut. Dies funktioniert auch, wenn durch den Verkauf der beworbenen Produkte ein Revenue, ja ein finanzieller Kreislauf generiert werden kann. Wenn nicht, ist es mehr oder minder betriebswirtschaftlich sinnlos oder wie man hierzulande so schön sagt, Liebhaberei. Klar ist dieses Thema noch viel komplexer, aber ich verspüre gerade nicht die Lust, hier noch weiter zu graben. Das geöffnete Loch ist tief genug, der Einblick groß genug.
Egal. Bevor es jetzt noch trockener und uninteressanter wird, wechsle ich schnell das Thema. Ich schreibe und rede mich sonst noch in einen fieberhaften Gedankenkreisel hinein. Ich wollte mit euch ja stattdessen noch meine frischen Erfahrungen mit Körpertemperaturen jenseits der 40 Grad Celsius teilen.
Es gibt mehrere mir schon bekannte und erlebte Wege zur inneren Stille, ja, dem Wachsein ohne zu denken. Mitte Zwanzig war es mein damaliger spiritueller Lehrer Alexander in Wien, der mich gekonnt durch den Lärm meiner eigenen Gedanken führte, bis ich eines Tages im stillen Kämmerchen plötzlich vor ihm saß begleitet von den Worten: „There is too much noise. What is it that I am trying not to say?“. Erstmals machte ich einen Schritt hinter meine Gedanken und fühlte mich nicht mehr per se und immer damit verbunden, ja emotional involviert. Wenn man keinen Zugang zu der Welt hinter den Gedanken bekommt, hilft es oftmals schon die Pausen zwischen den Wörtern als Stille zu erkennen. Vielen hilft auch die Frage, „Wer bin ich, wenn ich nicht denke?“ ein bissl am Weg dorthin. Manche erleben Stille im Musizieren, manchen gelingt es beim hingabevollen Ausüben einer Sportart, manchen in der Kiste beim Liebe machen, manchen nach dem Rezitieren von Mantren oder Gebeten, manchen kurz vorm letzten Spritzer oder Bier, manchen kurz nachm letzten Joint, manchen durch schlichte Meditation oder wie auch immer. Ich kenne alle Wege ein bissl und praktiziere meistens das Aufsuchen der Stille durch bewusstes Wegatmen sämtlicher Gedanken bis es eben still wird im eigenen Köpfchen. Oder spiele einfach frei drauf los am Klavier. Herrlich. Ich Liebe die Stille und ich glaube, sie liebt mich auch. Scherz. So wie, der von mir sehr geschätzte Josef Hader in einem der wohl besten Österreichischen Filme namens „Indien“ so schön an die Amerikanischen Ureinwohner („Indianer“ darf man ja glaub ich nicht mehr sagen) erinnert: „De aundan, de Indianer, de sitzen wochenlaung vorm Zöt und hoidn de Pappn.“. Herrlich.
Der mir neueste Weg zur gedanklichen, inneren Stille offenbarte sich mir vor wenigen Tagen bei 41,4 Grad Fieber. Unter echt heftigen Muskel-, Nerven, ja schlicht Körperschmerzen leidend und jammernd lag ich da mit meinem Nicht-Männerschnupfen und hatte längere Zeit tatsächlich Angst und Panik - ja, ich mag keine Krankenhäuser und wollte mit der lieben Corona echt keinen Ausflug dorthin unternehmen. Ich bin zwar unternehmenslustig, aber nicht so. „So lange dein Blutsauerstoffgehalt nicht unter 85% fällt, kannst beruhigt daham liegen bleiben“, meinte meine liebe Ärztin locker und Corona erfahren am Telefon. So lag ich da, im Kopf ein ängstliches Kopfkino auf Dauerschleife und am Handgelenk meine Apple Watch, stets am Puls und Blutsauerstoffgehalt checken. Ein Horror. Echt ned lustig, auch wenn ich es jetzt so halblustig nacherzähle.
Gerade als ich begann mich mit dem Bild des Axels im weißen Krankenhauskittel irgendwie anzufreunden, gab mein Denken w.o. . Ja, ich konnte plötzlich nicht mehr denken beziehungsweise meinen vielen selbst generierten Gedanken folgen. Sie flogen wie durch ein plötzlich bei Sturm geöffnetes Fenster hinaus in die Ferne. Aber ich schlief auch nicht oder träumte dies, nein. Alles tat weh, nur meine Gedanken nicht mehr. Es wurde still. Ja, ich wurde still. So lag ich da, fühlte, atmete und dachte nicht mehr. Ich kann nicht genau sagen, wie lange dies so dauerte - mein Zeitempfinden war wie weggeblasen. Keine Zeit, keine Gedanken. Und: kein Selbstbild mehr. Einfach nur sein. Nur mehr „ich bin.“, ohne jeglichem Zusatz. Keine Beurteilungen, keine Sorgen, keine Angst, keine Selbstvorwürfe, keine Zweifel. Wach, im Jetzt, aber nicht sich schwach oder krank fühlend. Und alles a bissl wurscht, wie man hier so schön zu sagen pflegt.
Irgendwann griffen die ersten beiden Ibuprofen 400mg Tabletten. Sie holten mich zurück in die Welt der Denkenden. Ich fühlte mich körperlich sukzessive wieder besser und mein Fieber sank auf angenehme 39,2 Grad. „Hui, was für ein Trip“, dachte ich als einen der ersten mir wieder bewusst gewordenen Gedanken. Irgendwann schlief ich dann ein und wachte ein paar Stunden später abermals komplett nass geschwitzt wieder auf. Ach ja übrigens: Ab 40 Grad Fieber schwitzt man nicht mehr so wirklich - da wird alles ganz schön trocken, da oben. Auch nicht uninteressant, finde ich.
Nun gut, so schnell möchte ich diesen Stille-Zugang allerdings nicht mehr erleben müssen - da gibt es wie bereits geschildert bessere Zugangstore. Die Coronaviren hat mein Fieber offensichtlich in die Flucht geschlagen, geblieben ist nur mehr eine Superinfektion der Nebenhöhlen, die wir nun hoffentlich bald mithilfe von Antibiotika beenden können.
Das neue Jahr hat begonnen und schon die ersten Überraschungen mit sich gebracht. Siehe auch meine Geschichte mit dem Titel „Angst oder Zuversicht“. Der liebe Februar zeigt sich bereits von seiner altbewährten besten Arschgesichtseite. „Siehst du nicht, die Welt zerbricht. Nicht.“, singe ich am Schluss von „Lieber Februar“ und mit dieser Erkenntnis und Zuversicht möchte ich meinen heutigen Aufsatz, ja dieses superromantische Kurzreferat zu Ende bringen. Das Wesentliche Tag ein und Tag aus bleibt wohl der Fokus, ja die tägliche Suche nach freudvollen Momenten und Augenblicken. Jedes Mal, wenn man fündig wird, macht dieses Leben Sinn. Sowie jeder Moment der Stille. Am besten ohne Fieber. Und ich bleib dabei: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
Das Zeitalter der Algorithmen - der All-Go-Rhythmus, wo jeder mit muss - oder doch nicht?
Unsere modernen Zeiten haben in den vergangenen Jahren so viele, schöne, neue Begriffe, ja Neologismen mit sich gebracht, dass man aus dem Erfassen, Sammeln und Begreifen fast gar nicht mehr rauskommt. Permanent gibt es ein neues Wort, einen neuen Trend, ein neues Must-Have oder Must-Do, welches dem eigenen, schon leicht ergrauten Wortschatz hinzugefügt wird oder werden sollte. Aber muss man diesen Wortschatzpenetrationen tatsächlich immer Folge leisten?
Gerade natürlich die „neuen Medien“, wie sie seltsamerweise nach wie vor immer noch genannt werden, sind stets ein fruchtbarer Boden für sämtliche Wortschatzerweiterungen. Es sind natürlich viel zu viele, um sie, in meinem heutigen, ja wöchentlichen Kurzreferat über dies und das, ja die ach so romantische Welt da draußen, alle zu nennen - auch kenne ich sie mit Sicherheit nicht alle.
Als ich vor über 20 Jahren mein Theater-, Politik- und Publizistik-Studium wegen eines lukrativen Jobangebotes in der damals „New Economy“ genannten Web- und Werbeagenturwelt beendete, war ich mit Sicherheit näher am heißen Kochtopf voller zukunftsträchtiger Neologismen als jemals danach wieder. Ich arbeitete als 21 Jähriger bei einer Tochterfirma der damals größten Österreichischen Webagentur als autodidakter Webdesigner, Konzeptionist und man höre und staune, „Community Manager“. Während ich knapp zwei Jahre lang diesen trendigen, modernen und auch gut bezahlten Job machen und dabei miterleben durfte, wie mit dem NEMAX eine gesamte Börse und der dazugehörige Wirtschaftszweig komplett den Bach runter ging, sinnierten wir oft und öfter über neue Geschäftsideen im Internet und über zahlreiche neue Wortkreationen.
Die Zeit war geprägt von Ideenreichtum und Sensationsnachrichten von Erfolgsgeschichten und Megasellern im Silicon Valley. Ich erfand die sogenannte „Transparent Community“ oder eine online basierte Plattenfirma namens „Solarplexx Music“, wo die Community die Artists und Acts der Zukunft unter Vertrag nimmt und nicht mehr wie üblich irgendwelche Einzelpersonen namens A&R, also Artist & Repertoire Manager bei Plattenfirmen. Und dies noch vor Beginn der Casting TV Shows Ära. Ich bekam, zum Beispiel, um sage und schreibe nur drei Wochen das weltweite Patent für SMS basierte Auto-Alarmanlagen nicht. Ein etwas älterer, aber auch blutjunger Schwede kam mir zuvor. Heutzutage funktioniert fast jede Alarmanlage auch mit Nachrichten an Besitzer oder Einsatzstellen im Falle des Falles. Tja.
Nun gut, to make a short story short: Die Tochterfirma der Mutterfirma ging genau so baden im Sumpf der New Economy, wie so viele andere Firmen damals auch. Und was bedeute dies für mich persönlich damals? Genau: ich wurde vom aufstrebenden Jungkreativschädel zum sogenannten „Jugendlichen Arbeitslosen“. Ja, über sechs Monate lang musste ich regelmäßig zum hiesigen Arbeitsmarktservice, um mir mein Arbeitslosengeld zu holen bzw. zu erkämpfen. Das Problem war nämlich, dass es meine gerade verlorenen Jobs als solches noch gar nicht in der Arbeitsmarktvermittlungsdatenbank gab. „Community Manager“ oder „Webdesigner“ waren einfach zu frische Neologismen und Jobbezeichnungen für das typisch Österreichisch langsam getaktete Jobvermittlungsbüro. Und so kam es, dass ich als unvermittelbar eingestuft wurde - ja zu einem weiteren Problemfall in der Kartei meiner überforderten Betreuerin. Zurück an die Universität wollte ich aber auch nicht mehr - auch bekam ich durch das Exmatrikulieren keine weitere Familienbeihilfen-Unterstützung vom Vater Staat. Ich hing somit plötzlich völlig in der Luft, konnte schon viel, war voller jugendlichem Elan und unzähligen Ideen, besuchte aber anstatt neue Konzepte zu kreieren, AMS Zwangskurse wie zum Beispiel „Wie bewirbt man sich richtig?“. Hallelujah, was für ein Crash, was für eine Zeit. Meine liebe Freundin D. (siehe meine Geschichte von letzter Woche) zog wieder bei mir ein und begleitete mich widerwillens und ungefragt und auch nicht besonders hilfreich durch diese dunklen Monate. Tja, es kommt eben erstens immer anders und zweitens als man denkt.
Irgendwie ging es aber weiter. Dies ist aber nicht wirklich der Kern meines heutigen Aufsatzes. Heutzutage weiß man, dass viel mehr als man damals zu denken wagte, aus der verstorbenen New Economy Zeit übrig blieb. „Online Communities“ erklärten wir damals bei unzähligen Präsentationen bei u.a. großen Konzernen wie BMW, MTV und so weiter, jedes Mal wieder von Grund auf und argumentierten von A bis Z für diese webbasierten Produkt- und Interessensgemeinschaften. Meistens erfolglos und begleitet mit den Worten „brauchen wir nicht“ oder „das wird sich nicht durchsetzen“ von der Agenda gestrichen. Heutzutage hat wohl jede Marke, jedes Produkt, ja jedes Event, etc. seine/ihre eigenen Online Communities - ohne geht es quasi gar nicht mehr. Nicht mehr wegzudenken, faktum fidibum.
Auch dass sich „Online Shops“ durchsetzen werden war uns damals klar - aber eben nur uns. Meistens hörten wir Sätze wie „die Menschheit wird immer on land einkaufen gehen“. Nun gut, der Rest ist eben Geschichte. Konzerne wie Amazon, Thomann, Zalando oder wer auch immer lachen sich ins Fäustchen.
Auch der Terminus „Algorithmus“ kam mir damals kurz nach der Jahrtausendwende erstmals durchs Gehör geworfen. Ich meine, ich kannte den Begriff schon ein bissl aus der Matura Vorbereitung in Mathematik, aber damals war das nur eine Randnummer in der Welt der Begriffe und Begrifflichkeiten. Ich lernte von meinen damaligen Webagentur Kollegen in der sogenannten Technikabteilung, ja unseren schrägen Programmierern und Computergeeks, was ein Algorithmus ist und begriff es auch so ungefähr. Im Duden wird „Algorithmus“ als „Verfahren zur schrittweisen Umformung von Zeichenreihen; Rechenvorgang nach einem bestimmten [sich wiederholenden] Schema“ beschrieben. Alles klar.
Ich mache jetzt einen bewussten Sprung auf der Zeitachse - unsre Zeit ist wertvoll, ich weiß. Die New Economy war tot, das Internet Business ging aber klarerweise dennoch weiter. Immer mehr Must-Haves aus den USA kamen zu uns rüber. Da ich auch wieder Musik machte und neue Songs schrieb, wurde mir von einem Freund und Medienfachmann in Wien geraten, mir unbedingt und wie man so schön sagt asap, also so schnell wie möglich, ein MySpace Profil anzulegen. MySpace war damals das heißeste Wunschtraumsprungbrett in die große, weite Musikwelt. Ziel war, mit dem eigenen MySpace Profil so viele Aufrufe wie möglich zu generieren. Ja, erstmals bekam ich es damals mit dem neumodernen Begriff „following“, also am besten mit „Folgschaft“ oder banal „Reichweite“ übersetzt, zu tun. Schickte ich Jahre zuvor noch Demo-CDs an Plattenfirmen mit der Hoffnung entdeckt zu werden, so ging es ab MySpace fortan nur mehr oder hauptsächlich um das vom Künstler selbst generierte Following.
Im Unterschied zu heute, waren damals die Algorithmen aber tatsächlich noch ganz anders programmiert. Mein genaues Following auf MySpace weiß ich natürlich nicht mehr, aber manche Medienfachleute und Musikkenner in meiner Heimat sprachen damals von durchaus beachtlichen Zahlen. Ein Jahr später, als ich gerade in Los Angeles verweilte, wurde ich von meinem damaligen musikalischen Umfeld aufgefordert, unbedingt und asap ein „Facebook“ Profil anzulegen. Dies sei der nächste große Hype und auch diesen sollte man als junger, aufstrebender, brotloser Künstler nicht auslassen. Als ich mir Facebook damals im kleinen Zimmer in Kalifornien erstmals anschaute und installierte, dachte ich mir, „Alter Schwede, all diese Features und alles was ich da sehe, kenn ich ja schon aus meiner Webagentur Zeit…“. Ja, für mich als ehemaligem Webkonzeptionisten war dies alles nicht neu. Nur war eben die Zeit nun reif geworden für „Social Media“ - auch ein Neologismus dieser Zeit von damals. Und bis heute frage ich mich, was an den sozialen Medien tatsächlich so sozial sein soll…aber egal, nicht immer muss ein Neologismus richtig und absolut passend sein. Die Zeit muss passen und die einhergehenden Umstände.
Als ich damals 2007, auf YouTube, so einer weiteren, neuen Online-Kiste aus Amerika, wo man selbstgenerierte Musikvideos im Möchtegern-MTV-Style selbst veröffentlichten konnte, meinen Song, ja mein mit MiniDV Kamera auf der Terrasse in LA gefilmtes Video zu „In Your Hands“, von meinem „Wedding Songs“ Album, auf YouTube stellte, erreichte dieses binnen weniger Tage und Wochen sage und schreibe über 50000 plays. Ohne Werbeschaltung (so was war damals noch gar nicht möglich), ohne bekanntem Namen, ohne nichts. Ja, Airplay, auf zig Radiostationen an der US Westküste, aber damit hatte es wohl wenig zu tun - die klassischen Medien waren damals mit der Onlinewelt noch kaum bis gar nicht verlinkt. Einfach ein organisches Wachstum, weil es anscheinend vielen, mir unbekannten Menschen gefiel, trotz der fragwürdigen Videoqualität von damals. Menschen gefiel der Song, der Witz des Videos und sie teilten es.
Meine Coverversion vom wunderbaren 80s Robert Palmer Song „Johnny & Mary“ erreichte 2008 innerhalb weniger Tage gleich ca. 80000 Plays und dies gleich zweimal, weil mein befreundeter Kameramann in Wien, der damals den Videodreh nützte, um die Videofunktion seiner brandneuen Canon EOS 5D MrkII auszuprobieren, das Ergebnis unseres Test-Shootings ebenfalls gleich auf YouTube stellte. Wow, dachten wir, das ist schon viel! Fett.
Und war es auch, an heutigen Zahlen gemessen. Die Algorithmen auf sämtlichen Plattformen wurden über die Zeit immer schneller und öfter im Interesse ihrer Betreiber und Besitzer modifiziert. Das Ziel dahinter ist und war natürlich klar: Geld. Menschen sollen für ihre Reichweite, ja ihr Following bezahlen müssen - so einfach darf und durfte dies nicht weitergehen.
Und so kam es, dass wir Künstler, Musiker, Urheber und Videomacher weiterhin gratis unsere Ergebnisse, ja unseren Content zur Verfügung, ja online stellen dürfen, aber andere daran verdienen sollen. Ja, okay, wenn man ganz hohe Following-Zahlen erreicht, bekommt man mittlerweile vom Kuchen nen Krümel zurück. Immer noch genug für manche, die von den durch Werbung generierten Revenues leben können und mit ihren Trendviren als Influencer die Screens meiner Söhne vollspamen. Aber ja, es gibt auch wirklich gute und interessante YouTuber wie Rick Beato, zum Beispiel oder wen auch immer. Wie immer hat alles sein Für und Wider.
Als ich 2015 mein Album „MA’AN“ fertig hatte, wurde dies von meinem Umfeld mit einem Musik-Manager in London geteilt. Spontan war dieser erfahrene Musikbusiness-Fachmann von meiner Stimme, den Songs, ja summa summarum sehr begeistert und wollte sofort etwas damit machen. Ich freute mich und wartete neugierig auf die kommenden Schritte und Taten. Einige Tage später bekamen wir die folgende Antwort: „As I said, Axel Wolph is of great potential and I still do love his new songs and album. Apart from that, I did a following research on him and found out, that there is almost no following right now - so let’s wait.“ Das genaue Zitat von damals müsste ich jetzt suchen, interessiert mich aber jetzt nicht - sinngemäß war es so.
Und was lernen wir daraus? Oder besser gesagt was lernte ich daraus? Ja, dass wir im Zeitalter von Algorithmen und Denkweisen leben, die hauptsächlich auf Quantität und nicht Qualität beruhen. Auch deshalb, weil sich quantitative Kriterien natürlich viel viel leichter in Zahlen erfassen und bewerten lassen, als qualitative. Ob etwas gut ist, kann ein Computer nicht beurteilen - ob etwas oftmals geteilt und angeklickt wurde schon. Egal.
Ein anderes Beispiel: 2021 schaltete ich mit Hilfe eines sehr guten Freundes und mittlerweile Online-Marketing Fachmannes eine Facebook Targeting Kampagne mit meinem Video zu „Donau“ feat. Florian Eggner, einem abermals selbst gemachten Video zu einem ruhigen, far off mainstream Klavierstück meiner „Piano, piano“ Serie. Ich investierte €100,00 und ließ mich überraschen. Die Laufzeit dieser ersten bezahlten Werbeschaltung war, so weit ich mich erinnern kann, ca. drei Wochen. Und wir staunten nicht schlecht: „Donau“ performte großartig, wurde ca. 700mal geteilt und generierte über 1000 likes alleine auf Facebook - tagtäglich kam aus der ganzen Welt - sogar aus British Columbia, woher mich jemand mit berührenden Worten um die Noten des Stückes bat - schönes Feedback und wir waren echt begeistert.
Ja, und dann? Klingt doch großartig, oder? Tja, nach drei Wochen war die bezahlte Kampagne vorbei und plötzlich gab es von einem Tag auf den anderen keine Likes, Views oder Shares mehr. Die Zahlen blieben auf Knopfdruck stehen. Und hier beginnt das ganze Theater für mich spooky zu werden: die aktuellen Algorithmen von Facebook und Konsorten unterbinden sämtliches, organisches Wachstum. Ja, Mundpropaganda bringt den Betreibern kein Geld. Wohl ähnlich wie in der klassischen Werbung im TV oder Radio: so lange man für die Werbeeinschaltung bezahlt, wird sie gezeigt und unterstützt. Sobald die Zahlung endet, endet auch die Reichweite. Und das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für Instagram und so weiter.
TikTok hatte ich nur drei Wochen im Testlauf und wurde dann sofort mit ruhigem Gewissen wieder gelöscht. Nicht alles, was die Algorithmenwelt einem anbietet oder vorgaukelt, muss man mitmachen. Dies sage ich auch mehrmals wöchentlich meinen Söhnen. Und die hinter der vorgegaukelten Anfangsreichweite oder dem bezahlten Following versteckte Sucht ist ein weiteres, schwieriges Thema. Klar, jeder Mensch möchte gesehen und im besten Falle geliebt werden. Und wenn es im echten bzw. Onland-Leben eben nicht mehr funktioniert, dann eben im virtuellen Raum, ja in irgendeiner der mittlerweile vielen Online Communities, die damals zu meiner New Economy Zeit niemand brauchen oder haben wollte. Jetzt ersticken wir darin oder stopfen die Mäuler der Superreichen wie Zuckerberg (perfekter Name) oder wie sie auch alle heißen weiter mit unserem immer wertloser werdendem Geld. Achtung: kein Neid, just facts.
Bis sie alle platzen und mit ihnen ihre Plattformen, die damals wie heute tatsächlich niemand brauchte, um ein erfülltes, sinnbringendes, ja qualitativ hochwertiges Leben „on land“ führen zu können. Ja, ich bin und bleibe auf Facebook und Instagram, warum auch immer. Weil es mittlerweile dazu gehört und ich gerne auch Schönes, Berührendes, Freudvolles teile. Aber ich ärgere mich nicht mehr oder beginne mit meiner Freundin D. im Ring zu kämpfen, wenn mal wieder ein neuer Song oder ein neues Video nicht die Zahlen von damals erreicht. Mich freut es jedes Mal, wenn meine Musik jemanden erreicht und berührt. Vor ein paar Tagen bekam ich seit Langem zum Beispiel mal wieder Fanpost. Ja, einen Brief mit der Post mit der Bitte um vier Autogramme. Berührend, schön. Und „Lieber Februar“ haben sich seit Freitag schon ca. 100 Menschen angesehen. 100 mal mehr als niemand.
Es gibt die Menschen da draußen, die meine Arbeit berührt - das weiß ich. Man muss eben nicht jedem Algorithmus da draußen folgen. Dies nicht zu müssen ist auch immer wieder ein Schritt in Richtung individueller Freiheit. Somit bringe ich jetzt die vier Autogramme zur Post und versuche die mir zur Verfügung stehende Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
MEINE LIEBE FREUNDIN D. - Eine Hommage an eine lebenslange Freundschaft.
Unsere erste Begegnung hatten wir im zarten Alter von fünfzehn Jahren. Besser gesagt, ich war fünfzehn, ihr genaues Alter und ihre Herkunft weiß ich bis heute eigentlich nicht ganz genau. Daraus hat sie stets und bis heute ein gut gehütetes Geheimnis gemacht. Damals jedenfalls war ich blutjung und am Beginn meiner pubertären Selbstentdeckungsreise, stand kurz vor der ersten großen, lebenswichtigen Entscheidung Tennisprofi oder Musikus und war von ihrer Energie sofort in den Bann gezogen. Emotional von ihrem Handeln und spontanen Mitwirken so sehr ergriffen, dass meine Mutter sich besorgt einmischte und erstmals einen Arzt konsultierte. Dieser untersuchte mich von oben bis unten, ließ mich auf einem Bein stehen und mit dem Zeigefinger beidseits bei geschlossenen Augen meine Nasenspitze finden und berühren. Ich schaffte alle seine Tests mit Bravur und galt weiterhin als gesunder, junger, strammer Bursche. Ein junger Mann, der eben erstmalig und überrascht Bekanntschaft mit der lieben D. machen durfte. Emotional überwältigt und wie paralysiert saß ich da und schloss die liebe D. in mein Herz. Oder besser gesagt, sie schloss sich in meinem Herzen ein und blieb.
Dort trug ich sie fortan weiter durch mein noch so junges Leben. Eine leibhaftig gewordene Lebenspartnerin, stets an meiner Seite, stets im Hintergrund, aber immer da. Bald lernte ich auch ihre große Schwester A. kennen. Gemeinsam im perfekt abgestimmten Teamwork halfen mir D. und A. bei fast allen großen Entscheidungen oder führten diese sogar mit Nachdruck herbei. Zum Glück vertraute ich immer wieder meiner eigenen inneren Stimme, ja meiner Intuition und übertönte damit den oftmals von D. generierten Lärm in mir. Dies dauerte allerdings eine Weile, bei vielen, ja viel zu vielen Streit- und Schreigesprächen mit D. musste ich als junger, tapferer Verlierer den Ring verlassen.
Als mir mein Großvater mütterlicherseits nach meiner Rückkehr von der mit der erfolgreichen Matura wohlverdienten Interrail Zugreise quer durch Europa in der damaligen Küche meiner Eltern als einzigen und jüngsten in der Familie offenbarte und ankündigte, dass er seinem Leben nach dem Ableben seiner Frau ein Ende setzen möchte und dies zwei Wochen danach auch tat, musste ich erkennen, dass die liebe D. wohl eine Freundin der Familie sein dürfte. Auch sein Vater wählte einen freiwilligen Austritt aus seinem Leben - als Künstlernatur wie sein Sohn wohl auch tief gezeichnet vom erzwungenen Mitwirken an einem Weltkrieg.
Mein Großvater wurde seines Zeichens als junger Mann und gezwungener Flieger für die Nazis in der Normandie abgeschossen, konnte sich mit dem Schleudersitz retten und kam, abseits der tiefen emotionalen Traumen, mit einer tiefen Kopfwunde nach dem Krieg nach Hause. So wurde es mir jedenfalls übermittelt, Genaueres weiß ich natürlich nicht, wird doch da und dort noch immer der Mantel des Schweigens über diese unmenschlichen Erlebnisse, dieses dunkle Kapitel der Menschheit ausgebreitet und so tief gehalten, dass möglichst an keiner Stelle Licht rein kann.
Als ich damals mit ihm in der Küche saß und mir mehrere Stunden lang seine Lebensgeschichte, ja, Erlebtes, Gedanken und Argumente für seinen Freitod anhörte, hatte ich davor in einem großen Kino am Leicester Square in London den Hollywood Blockbuster „Saving Private Ryan“ von Steven Spielberg gesehen. Dieser furchtbare Film spielt genau in der Normandie und zeigt auf schauderhaft realistische Art und Weise die Geschehnisse rund um die Invasion der Nazis in Frankreich. Als mir mein Großvater, seines Zeichens leidenschaftlicher Bildhauer, Holz- und Ton-Künstler, also dann in der bäuerlich eingerichteten Küche im elterlichenLandhaus aus 1757 von seinen Erlebnissen dort erzählte, hatte ich sofort diese grausamen Bilder im Kopf. Und er tat mir immens Leid - ja, ich konnte seine emotionale Welt sogar mitfühlen. Als er ein paar Wochen später beigesetzt wurde, war ich wohl der Einzige, der nicht weinte - irgendwie hatte ich zu viel Verständnis für seine Entscheidung entwickelt. Ich denke, aus heutiger Sicht betrachtet, auch da hatte die liebe D. ihre Finger im Spiel. Ein paar Tage davor schrieb ich unter Tränen den Song „Alright (As It Sings The Angels Choir)“ und hatte gemeinsam mit D. wohl schon viele Emotionen irgendwie musikalisch ver- oder besser gesagt bearbeitet.
Ja, D. ist eine Freundin der Familie und sie war schon länger in diesen familiären Kreisen präsent, dies war mir fortan klar. Auch meine, am 12.1. 2020 verstorbene Mutter war eine gute Freundin von D. Aber auch sie bekam gemäß ihrer Generation kaum bis nie die Chance mal ein ausführlicheres Gespräch mit D. zu führen. Auch sie schleppte die alte Familienfreundin still und heimlich, aber immer präsent mit durch ihr Leben und versuchte alles, um ihr nie wirklich genau zuzuhören. Sie ging erst gar nicht mit ihr in einen Ring.
Und was passiert mit Menschen, ja Gefühlen und Gedanken und Freunden wie die liebe D. wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkt? Genau, sie werden immer lauter und werden alles Mögliche versuchen, um gesehen, gehört und wenn möglich sogar geliebt zu werden. Alles was mit dem Menschsein zu tun hat, möchte gesehen und unterm Strich am Ende bestenfalls geliebt werden. Und dies war wohl schon immer so. Ich mache gerne ein kleines, ja für mich eigentlich wahrlich großes Gedankenspiel und mache dieses nun, wenn du möchtest kurz mit dir:
Nenne mir irgendeine Jahreszahl - du kannst dich dabei gerne an unserer christlichen Zeitrechnung bedienen. Du kannst dich dabei auch ganz weit rauslehnen und zum Beispiel 7356 Jahre vor Christi Geburt sagen. Oder 1548 Jahre später. Egal, irgendeine Jahreszahl. Egal welche du mir nennst, lautet meine weitere Ausführung so: Auch in diesem Jahr, ja zu dieser Zeit im Irgendwann vor uns, lebte jemand von dir ihr oder sein Leben auf dieser Erde. Sonst wärst du heute de facto nicht hier. Kein Mensch wurde bisher bewiesenermaßen aus dem Nichts erfunden. Wir alle haben eine tausende Jahre alte Vorgeschichte. Egal ob zu Lebzeiten von dem von mir so geschätzten Siddharta Gautama oder Jesus von Nazareth ca. 500 Jahre später. Egal ob zur Zeit der Mayas, Ägypter, Römer oder dem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648. Wir alle hatten da schon wen am und im Leben, sonst wären wir, wäre ich, wärst du heute im Hier und Jetzt nicht da.
Dieses Gedankenspiel berührt mich immer wieder zutiefst mit Ehrfurcht, Dankbarkeit, Respekt und Liebe. Es ist nach heutigem Wissenstand nicht widerlegbar und zeigt mir, dass das Leben an sich das größte Geschenk ist, das man erhalten kann. Du, ich, wir alle sind de facto Teil eines großen Ganzen. Egal, ob wir das nun wollen oder ob es uns passt. Es ist so.
Ich hatte bis heute viele, ja unzählige Momente des Schreiens und Streitens mit meiner Freundin D. Ich hörte ihr, zum Glück, auch mit professioneller Hilfe von anderen guten Freunden von D. in meinem bisherigen Leben immer wieder zu. Ich ging in den Ring mit ihr, kämpfte mit ihr, egal ob Schlammschlacht oder mit Boxhandschuhen und wollte, neugierig wie ich nun mal bin, auch immer wieder mehr, am liebsten von ihr selbst über sie Erfahren.
Heute weiß ich, dies hat mir geholfen. Immer wieder aufs Neue. Meistens wird die liebe D. im Jänner, rund um meinen Geburtstag, und dem logisch folgenden Februar laut. Als hätte ich sie vergessen, beginnt sie in mir zu arbeiten, kämpft mit giftigen Gedanken gemeinsam mit ihrer Freundin A. um meine Aufmerksamkeit. Sie erinnert mich mit ihrer wohl Jahrtausende alten Erfahrung an Gedanken, Gefühle und Geschichten, die ich eigentlich nicht mehr am Screen der ach so modernen Gegenwart zu haben scheinte. Sie zeigt mir mit der für sie typischen Vehemenz, dass ich nicht alleine bin. Ja, ich lebe dieses Leben nicht nur für mich allein , sondern auch für alle meine unzähligen Vorfahren und Nachkommen. Dieses eine, meine Leben ist demnach ein viel größerer Auftrag als das Erfüllen sämtlicher Todo Listen und dem Auffüllen und Leeren von Kontoständen.
Ein kleines Beispiel: Als ich mit fünfzehn Jahren ein Tennisturnier in Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesh, spielen durfte, wurde uns vor der Anreise gesagt, dass wir bettelnden Kindern niemals etwas geben dürften. Kein Geld, keine Süßigkeiten, nichts. Warum auch immer - manche Argumente wurden genannt, passierten meinen jugendlichen Gehörgang aber nicht wirklich - jedenfalls nicht bis nach innen. Da dieses Jugendweltranglistenturnier das erste einer Reihe von Turnieren im Asiatischen Raum war, flogen wir, ein Trainer, ein weiterer Spieler und Freund bis heute und ich, schon ein paar Tage früher dorthin ins völlig Unbekannte, um uns rechtzeitig zu akklimatisieren, hieß es. Wir waren in einem guten, ja für dortige Verhältnisse wahrlich noblen „Sheraton“ Hotel untergebracht und fuhren drei Tage vor Turnierbeginn immer mit einem für dort typischen Tuk Tuk, also einer kleinen, Vespa Ape ähnlichen Autorikscha zum Tennisplatz. Dieser hieß „Ramna Green“ und war wie ein Gefängnis mit hohen Mauern samt Stacheldraht an der Oberkante ummantelt. In diesen Mauern gab es kleine, offenbar mit Steinen von außen durchschlagene Löcher durch welche wir von Kinderaugen beim Tennisspielen beobachtet wurden. Auf den Straßen davor herrschte absolutes Chaos und unerträglicher Gestank und Lärm. Menschen schrien miteinander als wäre es die einzig mögliche Kommunikationsmöglichkeit, manche hockten am Straßenrand und machten unter ihrer Kutte ihr allmenschliches Geschäft ins Rinnsal. Was für ein Kulturschock für mich, unglaublich.
Zwei Tage lang beobachtete ich immer vor der Abfahrt mit dem Tuk Tuk hinter dem Hotel, dort wo die Küche die Speise- und Küchenreste einfach zu einer kleinen Mauer rauswarf, ein kleines, ca. fünfjähriges, typisch Indisch aussehendes Mädchen. Verwahrlost, schmutzig, mit großen Kulleraugen. Sie schleckte kaputte Eierschalen leer und stritt sich mit anderen Kindern um restliche Nudeln oder was auch immer der Küchenabfall so hergab. Ich fühlte mich wie ein Außerirdischer, wie ein untätiger Verbrecher, wie ein Mensch anderer Kategorie widerwillens.
Am dritten Tag, wir hatten uns gerade im Tuk Tuk abermals auf engstem Raum samt unserer vom Ausrüster zur Verfügung gestellten Tennisbags eingefunden, kam dieses Mädel dann plötzlich zu mir her gerannt und hielt ihre völlig dreckigen, verschmierten Finger zu mir rein ins Tuk Tuk. Ich wusste überhaupt nicht, was ich nun tun sollte, war ich doch schwer verunsichert durch unser vorangegangenes Anti-Bettler-Briefing. Spontan griff ich in mein Bag, da ich wusste, dass ich noch ein Stück Ritter Schokolade irgendwo aus der Anreise darin versteckt hatte. Ich nahm dieses einzige, kleine, quadratische Stück Schokolade und drückte es ihr in die Hand. Sie nahm das Stück in ihre rechte Hand, schloss diese und starrte mich an, bis wir abfuhren. Wenige Sekunden des beidseitig starren Augenkontakts später fuhr der Tuk Tuk Fahrer los. Ich blickte ihr nach so lange ich konnte - sie mir auch und hielt das kleine Schokoladenstück weiterhin in ihrer Hand. Ich deutete ihr nur mehr, dass sie es essen sollte, aber dann waren wir weg und sie für immer aus meinen Augen verloren.
Bis heute muss ich an dieses, damals nur ca. zehn Jahre jüngere, kleine Mädchen mit ihrem Kulleraugenblick und dem Schokostück denken. Tausende Male musste ich in meinen bald 44 Lebensjahren an diesen Moment denken. Wieso wurde sie dort geboren und ich hier? Wieso ist diese Welt so dermaßen ungerecht? Fragen, die wohl niemals eine Antwort finden werden.
Denn dieses Erlebnis steht für so viel Unerklärliches in unserer Welt. Auch damals wurde meine liebe Familienfreundin D. schon nach ein paar Tagen in dieser so fremden Umgebung mit Hilfe ihrer Freundin A. in mir fast unerträglich laut und drängte mich dazu, möglichst bald wieder nach Hause zu fliegen. Trotz ihrem Beisein und größtem Heimweh hielt ich irgendwie durch und spielte weiter, so gut ich halt konnte, Tennis. Absurd.
Viele, viele Jahre und unzählige Momente mit D. später, weiß ich, dass man die Depression nicht als Feindin, sondern eben als Freundin betrachten sollte. Ja, sie zeigt einem offensichtlich unabschüttelbar immer wieder aufs Neue, dass dieses Leben ein endlicher Prozess ist. Zumindest für mich und mein Leben gültig. Aber, wenn ich ihr zuhöre, ja sie mit meinen Sinnen wahrnehme, dann komme ich immer mehr zur klaren, ja wertvollen Erkenntnis, dass sie auch ein Teil dieses Geschenkes Leben ist. Sie gehört dazu. Sie ist ein Teil meiner Geschichte, ja von mir und all meinen Vorfahren. Je älter ich werde, um so klarer erscheint es mir, dass wir alle Freund und Freundin von D. sind. Auch, der von mir sehr geschätzte Viktor Frankl war schon vor einigen Jahrzehnten dieser Erkenntnis. Wir alle möchten vor allem eines: gesehen, geschätzt und im besten Falle geliebt werden. Und eben auch, die liebe Depression in uns allen.
Siddharta Gautama kam, meines Erachtens, als Mensch wie du und ich, nur halt vor ca. 2500 Jahren, ebenfalls zu dieser Erkenntnis summa summarum. Das Leben ist Leiden. Sein, wie mein und dein Leben ist ein zeitlich begrenzter Prozess. Wenn man dies, gerne auch mit Hilfe der lieben D., zeitlebens verinnerlicht, sich klar vor Augen führt, darüber aus der Stille heraus meditiert und sinniert (ich mag dieses Wort im positivsten Sinne), beginnt das Leben irgendwie jeden Tag aufs Neue von vorne. Das Leben ist und bleibt eine tägliche Geschichte.
Die liebe D. kann aber natürlich immer wieder unbeschreiblich nerven, einen gedanklich und einhergehend emotional quälen und einem den Tag oder das tägliche Erleben erschweren, klar, keine Frage. Das Leben und Erleben mit D. ist kein Honiglecken. Das ganze Leben ist und bleibt per se kein Honiglecken und deshalb gehört sie dazu und hat mir schon in vielen Lebenssituationen auch sehr geholfen.
Es gibt kein schlechtes Gefühl, außer man ignoriert oder bekämpft es. Was da ist, ist da. Und es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
ANGST ODER ZUVERSICHT - Ein neues Jahr - here we go again - oder kommt doch alles anders?
Nun sitze ich wieder da, hier in meinem Studio und sinniere für euch vor mich hin. Frisch zurück aus meiner kurzen Winterauszeit im geliebten Mojacar in Andalusien. 14 Tage gemeinsam mit meiner Familie im unwinterlich angenehm warmen Spanischen Süden - täglich wildromantisch kitschige Sonnenaufgänge, keine Todo-Listen, kein Notizbuch, kaum Stress, fast täglicher Morgenlauf und Tennis mit meinen drei Söhnen. Finanzen hinten angestellt, gut essen, bissl Motorradfahren durch diese atemberaubende Landschaft, ausschlafen, dies und das. Ja, ich muss mir selbst ehrlich eingestehen: mich hat ein wenig der Post-Auszeit-Blues erwischt.
Dies ist aber natürlich auch kein Wunder und ich überrasche mich damit nicht wirklich selbst. Der Kontrast von dort zu hier ist schon immens und je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, mich sich stets verändernden Lebensumständen anzupassen. Mein fast 75-jähriger Vater sieht dies mittlerweile gelassen und betrachtet dies als part of the deal des Älterwerdens. Okay, ich hadere noch damit. Aber warum? Gute Frage. Hier ein erster spontaner Antwortsversuch:
Weil ein Jahreswechsel auch immer wieder einen quasi Neustart bedeutet. Quasi deshalb, weil es ja eigentlich gar keinen Jahreswechsel gibt - ja, wir Menschen haben den Kalender erfunden und uns damit selbst erklärt, dass die Erde in ca. 365 Tagen rund um die Sonne kreist. Schön, aber unterm Strich ist trotzdem alles immer nur ein neuer Tag nach dem anderen und das Leben schreitet genau in diesem Tempo voran und nicht anders. Ich hadere wohl deshalb damit, weil man mit fortschreitendem Alter oft genug erfahren musste, was so ein Jahr alles mit sich bringen kann: Erfolge, Misserfolge, gute wie schlechte Überraschungen, Krankheiten, Sorgen, alles was eben dazu gehört zum Dasein. Wünsche, Träume, Enttäuschungen…und unzählige Gefühle, manche schön, manche furchtbar. Und so ein Jahreswechsel, ja, so ein Neujahr kann sich gedanklich oft auftürmen wie eine riesige Feuerwalze, wie damals in Kalifornien leibhaftig erlebt oder ein emotionaler Tsunami, der bedrohlich am Horizont des eigenen Geistes gefühlt, ja imaginär immer näher kommt.
In Spanien hab ich in den letzten Zwei Wochen tatsächlich auch Medienfasten praktiziert - keine bis kaum Nachrichten im TV gesehen oder online gelesen, wenn auf Social Media präsent, dann eher freudvoll teilend und nicht konsumierend. Auch dies tat natürlich gut und beruhigte mich innerlich. Zurück im gewohnten Umfeld wollte ich gleich wieder wissen, was denn da draußen in der sogenannten großen, weiten Welt so passiert: schauderhaft, angsteinflößend. Horrende Energiepreise und Lebenskosten, Krieg, Bedrohungen, Leid und Wahnsinn. Das alte übliche Dilemma widergespiegelt auf allen Kanälen. Hier wäre ein Neustart einhergehend mit einem Neujahr auch mal wünschenswert. Dies ist naiv, ich weiß.
Genauso naiv, wie zu glauben, dass sich in meinem eigenen Leben schlagartig alles verbessern könnte. Aber dies hofft man doch insgeheim, oder? Ab jetzt wird alles besser, denkt man, ja, hofft man. Ab jetzt kann ich vieles, wenn nicht alles viel besser machen als im letzten 365-Tage-Rundumdiesonnelauf. Mumpitz. Bullshit. Dumpfbackenfutter.
Somit nährt ein solcher Jahresbeginn auch immer wieder die inneren, althergebrachten Ängste. Aber man begrüßt diese per se nicht salopp oder easy-going wie alte Bekannte mit „Hallo, wie gehts?“, sondern startet das auf Horror-Hypothesen basierende Kopfkino und schreibt ungewollt sein eigenes, eventuell mögliches Untergangsdrehbuch. Ja, es könnte im neuen Jahr alles schief gehen. Ja, all meine Ängste und Sorgen, gerade als dreifacher Familienvater, könnten wahr werden. Aber genau auf diesem mind games trip bleibe ich nicht hängen. Zu oft schon erlebt und es kam dann doch immer wieder anders und tatsächlich besser als jemals erdacht. Dies erinnert mich gerade an die von mir so geschätzte US-Amerikanische Serie „This is Us“. Zwei der ProtagonistInnen, das Ehepaar Beth und Randall Pearson, machen immer wieder ein sogenanntes „Worst Case Szenario“-Spiel, wo sie sich gegenseitig offen und ehrlich sämtliche Horrorszenarien und die einhergehenden Ängste gegenseitig schildern. Großartig, wie ich finde, denn dieser direkte, konkrete, ja mutige Diskurs zweier Lebenspartner hilft tatsächlich im Umgang mit unseren alltäglichen, urmenschlichen Ängsten. Durch das klare, transparente, emotional ehrliche Ansprechen und Schildern werden Ängste oft am Keim erstickt. Und genau darum gehts, unterm Strich: unkontrollierte, unbewusste Gedanken erzeugen Gefühle und können sich wie ein innerlicher Tornado hochschrauben.
Ich transformiere durch bewusst aufgesuchte Stille, ja dem Wachsein ohne zu denken, ja, Meditation, diese negative Energie gerne und sinnbringend in Zuversicht und Vertrauen an meine eigene Fügung. Ich formuliere dann lieber so klar wie möglich meine Wünsche und schreibe diese nieder. „Auf Papier können Worte verweilen“ singe ich und schrieb ich in „Nachts“, meinem letzten Song für mein „ROMANTICK“ Album. Die eigene Vorstellungsgabe bewusst einsetzen, um klare Visionen, Träume und Wünsche zu definieren. Und dies resultiert dann schönerweise immer wieder in Zuversicht. Oftmals sogar in Vorfreude auf das Ungewisse. „You have come so far“ singe ich im opening song meines „MA’AN“ Albums - und genau diese Message, ja dieses sinnvolle Gedankenspiel möchte ich euch heute auch mitgeben für die kommende, dritte Woche des neuen Jahres 2023: Dass man hier und heute sein darf und sein kann, beruht auf der Tatsache, dass man schon sehr viel im Leben geschafft und gemeistert hat. Das Jetzt, ja das Sein in diesem Moment ist der schönste Beweis dafür, dass man sich den Herausforderungen des Lebens erfolgreich stellen kann. „Everything is happening for you and not to you“, sagt die spirituelle Lehrerin Byron Katie gerne. Ja, dem kann ich tatsächlich etwas abgewinnen.
Ich habe demnach für 2023 tatsächlich viel Schönes, Traumhaftes und Erfüllendes auf meiner Wunschliste. Und ich freue mich drauf, wie auch immer alles passieren wird. Ich möchte mich weiterhin tagtäglich auf die Suche nach freudvollen Momenten begeben. Ich möchte für meine Söhne, meine Familie und Freunde da sein - ich möchte meine Leidenschaft für Musik, Kunst und Sport weiterleben und ja, auch da und dort mit euch meine Phreude, Gedanken, Gefühle und Geschichten teilen dürfen. Wie auch hier in meinem ROMANTICK Podcast - es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
MEETING WITH A STRANGER - BEGEGNUNGEN DER BESONDEREN ART (Teil 4): „Die Nacht am Flughafen in Washington“.
Nun ist es also erstmals passiert: ich konnte den Dienstag Jour Fixe für meinen Podcast diese Woche aufgrund einer dringlichen Filmmusik-Abgabe nicht einhalten. Da ich für meinen Podcast keine Geschichten vorproduziere, sondern mir tatsächlich jeden Dienstag Vormittag die Zeit zum Schreiben und Vorlesen bzw. Einsprechen nehme - siehe auch meine Geschichte „Disziplin ist die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen“ vom 18. Oktober - komme ich diese Woche erst heute dazu. Ich hoffe, es nimmt mir niemand übel und ihr seid weiterhin dabei, wenn ich irgendwas aus meinem Leben zum Thema „ROMANTICK - Gefühle, Gedanken, Geschichten“ zuerst in meinen Studio Apple tippe und dann vorlese.
Irgendwie beschäftigt mich derzeit immer noch das Thema bzw. die Rubrik „Meeting with a stranger“. Da gabs doch noch mehr in meinem Leben als die paar bisher geteilten Geschichten, sei es mit Tier oder Mensch gewesen, fällt mir gerade retrospektiv auf. Und ich finde, genau in Zeiten wie diesen, wo Unsicherheit und Ungewissheit permanent zum Thema gemacht wird in allen Medien, tut es gut, wenn man sich an derartige Treffen und Momente der schrägen, ja oft magischen Zusammenkunft mit Unbekannten erinnert.
Während meiner Zeit in Los Angeles lernte ich, dass es oft sehr gut tut, wenn man bewusst eine falsche Abzweigung, ja einen unbekannten Weg einschlägt, einen bewussten Perspektivenwechsel sozusagen. Damals praktizierte ich dies gerne mit dem Auto - gerade in LA, wo man täglich stundenlang im Auto sitzen muss, wenn man auch nur irgendwas machen möchte. Ich hatte damals nie ein Navi bei mir - es war noch die Zeit vor Smartphones und Navi immer und überall - und musste mich so oftmals rein auf meine Sinne und Erinnerung verlassen. Gerade an Tagen, wo ich mir bewusst eine Auszeit vom Schreiben, Aufnehmen, Livespielen oder dem Stress vor Ort nahm, setzte ich mich ins Auto und fuhr frei drauf los. „Jetzt rechts, jetzt links“ sagte ich am Steuer meines PT Cruisers zu mir und fuhr dann oft so lange, bis ich mich wieder irgendwie orientieren konnte. Und im weitläufigen Los Angeles und Kalifornien kann dies auch mal einige Stunden dauern. Das Schräge und Schöne daran ist, dass ich mich bis heute an wohl jede dieser Irrfahrten ins Unbekannte erinnern kann. Heutzutage fahre ich - sofern es nicht November, Dezember, Jänner oder Februar ist - gerne mit dem Motorrad ins Blaue. So hab ich in den letzten Jahren hier in meiner alten, neuen Heimat auch dieses kleine Dreiländereck gut kennengelernt - auch ein schöner Fleck Erde, wow, aber dies wird vielleicht mal eine andere Dienstagsgeschichte.
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ schrieb schon der von mir so geschätzte Hermann Hesse 1941 in seinem wunderschönen Gedicht „Stufen“. Ja, damit hat dies wohl alles etwas zu tun. All meine bewussten Irrfahrten, meine bewusst gewählten neuen Perspektiven und Handlungen schlagen zeitlebens in diese Kerbe. „Sei mutig und gehe neue, unbekannte Wege“, sagte ich schon oft zu mir in meinen fast 44 Lebensjahren. Und stets: „Folge deinem Herzen, mache wofür du innerlich brennst!“. Am Ende „kommt doch alles so, wie es war“ singe ich in meinem Romantick-Song „Wie es war“. Ja, aber die Erlebnisse durch diesen Mut zum Kopfsprung ins Unbekannte, machen dieses eine Leben auch so lebenswert.
Nun zur heute erinnerten Geschichte zum Thema „Meeting with a stranger“. 2007 folgte ich einem inneren Ruf und begab mich samt neuem Album „Wedding Songs“ zum zweiten Mal und erstmals ganz alleine nach Los Angeles. Ja, genährt und motiviert vom Traum, es dort, in der sogenannten großen, weiten Welt, mit meiner Musik zu versuchen. Die Songs selbst hatte ich in meinem Wiener United Indies Studio, im Souterrain des Haarsalons „folgeeins“ meiner Lebenspartnerin Athena, fertig aufgenommen und gemischt. Ich wollte neue Songs schreiben, mein quasi fertiges, noch ungemastertes Album promoten (es lief dann auf rund 90 Radiostationen an der Westküste!) und wenn möglich, auch mal live spielen in der Stadt der verlorenen Engel, wie man sie vor Ort gerne und zutreffend nennt.
Ich wählte eine Flugroute von Wien, meiner damaligen Homebase, via Washington nach Los Angeles. Am Flughafen in Wien hatte ich kurz vorm Boarding noch eine, für mich legendär heftige Panikattacke. Ja, ich konnte vor Angst kaum den Flieger betreten - es gab jedoch keinen Weg mehr zurück. Da musste ich jetzt durch.
In Washington, müde vom Flug angekommen, musste ich sogleich zum sogenannten „Immigration Procedure“, sprich zur mühsamen Einreisescheiße. Dort warteten in einem ca. zwei Meter niedrigen (ich bin 1,90m groß) , riesigen Saal bereits hunderte, wenn nicht tausende Einreisewillige auf deren Einreisebewilligung. Ein purer Wahnsinn - die Paranoia durch 911 war da gerade immer noch am gefühlten Höhepunkt. Ich hatte ein Touristenvisum und kam nach ca. drei elendslangen Stunden endlich zum Schalter bei einem Afroamerikaner mit Stiernacken und dunkelst eingefrorenem Blick. Wie ein Roboter auf Sparflamme fragte er mich seine Standardfragen ab. Und dann noch der nötige Fingerabdruck-Scan. Einhergehend mit der unsicheren Frage „This one or this one?“ zeigte ich ihm unbewusst und völlig unabsichtlich nach meinem Zeigefinger den Stinkefinger. Er lachte de facto nicht und winkte mich durch, so wie man eben ein Masthuhn kurz vor der Schlachtung abarbeitet und zum Grande Finale durchwinkt.
Schon während der stundenlangen Ansteherei wurde mir bewusst, dass ich meinen American Airlines Anschlussflug nach LAX nicht erreichen werden kann. Wieder Panik in mir, aber irgendwie erfolgreich ignoriert und still und heimlich während diverser small talks mit unbekannten AnsteherInnen aus der ganzen Welt halberfolgreich weggeatmet. Meinem Gepäck erging es währenddessen viel besser und so war es schon am Flug nach LA als ich erfahren musste, dass ich erst um sechs Uhr früh des Folgetages weiterfliegen könnte.
So stand ich nun da, am Flughafen in Washington um kurz nach elf, abends, ja nachts, völlig erledigt und hungrig. Der Flughafen leerte sich rasant und mir wurde schnell klar, dass ich noch was Essbares auftreiben musste - eine ganze Nacht alleine am völlig fremden Flughafen unter ausschließlich Fremden ohne Nahrung - no way. In der Mitte des endlos wirkenden Terminals sah ich ein „Mexican Grill“ Flughafenrestaurant, welches offenbar, trotz halbgeschlossenem Rollladen, noch Speisen ausgab. Ich eilte mit meinem Trolley im Schlepptau so schnell ich konnte hin und schlüpfte halbsportlich grazil hinein zur Theke. Dort stand ein ca. 1,60m kleiner, vom Arbeitstag gezeichneter Mexican American und wartete offensichtlich nicht auf mich, den 1,90m großen Europäer mit Tweed-Sakko, riesiger weißer Plastikbrille und Kipferlpornobart. „Can I get something to eat?“, stammelte ich gestresst in seine Richtung. „Sure“, erwiderte er, mit leerem Blick. Ich bestellte so schnell ich konnte irgendeinen Grilled Chicken Salad, das quasi Erste, was mir in der endlosen Mahlzeitenangebotsliste am Display ins Auge stach. Drei Minuten später lag mein Grillhähnchensalat in der Plastikbox auf der Theke. Ich nahm ihn und wollte sogleich flüchten und den armen Hund von mir erlösen. Da fiel mir plötzlich auf, dass ich noch ein Besteck zum Verzehr des mit Sicherheit liebevollst zubereiteten Salates brauchte. So schlüpfte ich nochmals kurz zurück unter dem Rolladen mit den Worten: „Excuse me, Sir, all I need to eat my meal is a scarf and a knife!“ Er starrte mich wie versteinert an und sagte nichts. Ich wiederholte meinen Satz mit Nachdruck: „Excuse me, Sir, all I need to eat my meal is a scarf and a knife!“ Er starrte weiter und zeigte plötzlich mit dem Zeigefinger seiner rechten Hand zu einer Plastikbesteckwanne auf der Theke. Ich nahm dankend das schwarze Plastikbesteck und begab mich auf eine der unzähligen, leeren Sitzmöglichkeiten des Terminals.
Als ich den Salat öffnete und zu essen begann, dachte ich weiter über die skurrile Situation beim Mexikaner nach. Irgendwas fühlte sich zusätzlich zur ohnedies schon heftigen Situation seltsam an. Und dann wurde mir schnell klar: Ich hatte zu dem kleinwüchsigen Restaurantmann tatsächlich mit Nachdruck gesagt, dass ich „a scarf and a knife“ zum Verzehr meines Salates brauche, also einen Schal und ein Messer. Dass Gabel „fork“ und nicht „scarf“ heißt, hatte ich ich wohl zum Zeitpunkt des hektischen Geschehens vergessen. Alter Schwede, wie peinlich. Der seltsame Künstlertyp will nen Schal und ein Messer für nen Salat. Legendär. Heute, in der Retrospektive, find ichs amüsant. Sehr sogar.
Nach ca. einer Stunde gesellte sich ein junger Mann aus Wien-Umgebung (woher genau, weiß ich nicht mehr) zu mir. Wir hatten in der Schlange vor der Einreiseabfertigung kurz ein Hallo-Wer bist du?-Gespräch, verloren uns aber dann im Chaos wieder aus den Augen. Wir erzählten uns stundenlang Vieles, redeten über Dies und Das und gaben uns unbekannterweise die erwünschte Rückendeckung bei der Übernachtung am Flughafen. Wir taten irgendwann mal beide so, als wären wir Herren über die Situation und stellten uns schlafend. Ich machte de facto die ganze Nacht kein Auge zu. Der Hühnersalat beschäftigte auffällig und hörbar mein Gedärm und die Angst lag mir im Nacken. Schon sehr viel Unbekanntes auf einen Schlag…
Auch seinen Namen hab ich nie erfahren. Um ca. fünf Uhr in der Früh, also eigentlich nur ein paar Stunden später, taten wir beide so, als wären wir gerade aus einem tiefen Schlaf in Mamas Schoß erwacht, wünschten uns beiden eine angenehme Weiterreise und verabschiedeten uns wie alte, gute Freunde.
Irgendwie kam ich an diesem Tag sogar noch nach Los Angeles. Blieb dort für drei Monate und schrieb die Songs für mein Album „The Weekend Starts On Wednesday“. Der Rest ist eine andere Geschichte. Oder auch noch mehrere. Und wie immer bleibt eines übrig: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar. Bis bald, euer Axel
MEETING WITH A STRANGER - DREI BEGEGNUNGEN DER BESONDEREN ART (Teil 3): „Mit Bob Dylan im Buddhistischen Kloster“.
Seit meinem achtzehnten Lebensjahr beschäftige ich mit mit der Lebensphilosophie und Geschichte von Siddharta Gautama, ja dem sogenannten Buddha. Damals, kurz nach dem Ende meines Tennisweges, mitten in meiner Pubertät, las ich zum ersten Mal „Siddharta“ von dem von mir so sehr geschätzten Hermann Hesse. Diese, von Hesse nacherzählte Geschichte vom wohl behüteten Prinzen, der hinaus zog in die Welt, auf der Suche nach seinem inneren Frieden und dabei alles auch Unerdenkliche über sich ergehen ließ, um schließlich seine Erleuchtung zu erfahren, hatte es mir schon damals sofort sehr angetan. Ich habe grundsätzlich ein Faible für spannende Lebensgeschichten und Biografien, muss ich mittlerweile eingestehen. Diese jene Lebensgeschichte berührt mich seither vielleicht auch deshalb so, weil ich selbst wohl behütet und beinahe wie ein kleiner Prinz aufwachsen durfte. Der ganze menschliche Gräuel, der natürlich auch schon in meinem Kindesalter auf diesem Planeten passierte, wurde konsequent von meinen Eltern von mir abgehalten, ja abgeschirmt. Ja, es wurde auch kaum vor mir gestritten oder derlei Unstimmigkeiten ausgelebt. Ich sollte es ganz besonders friedlich und liebevoll haben und dies musste ich über die Jahre erst verstehen lernen. Heute, bin ich meinen Eltern dafür dankbar und versuche tagtäglich, auch meinen drei Söhnen eine schöne, friedliche und liebevolle Kindheit zu ermöglichen.
In der Pubertät wurde damals schlagartig, eigentlich genau mit dem Ende meines Weges zum Tennisprofi und dem Lagerwechsel zur Musik, alles anders. Plötzlich war ich sehr einsam und alleine und konnte überhaupt nicht damit umgehen. Mein Vater war in seinem Job und meine Mutter in ihrer eigenen kleinen Welt zuhause gefangen. Wir hatten uns alle aus den Augen verloren und schliefen nur mehr unter einem Dach. Meine Schwester war ohnedies schon jahrelang ausgezogen und weg. Und so kamen damals auch Drogen ins Spiel - zum Glück zwar keine harten Drogen, aber immerhin regelmäßiger Alkohol- und Marihuana-Konsum. Binnen weniger Tage statt 30 Stunden Tennis und Training pro Woche und stets irgendwo auf Turnieren, plötzlich nur mehr ich, eine Gitarre, ein Klavier, gute Bücher und die Schule. Aus heutiger Sicht eine wirklich dunkle, aber auch prägende Zeit. Ein Crashkurs und Speed-Workshop zum Thema „das Leben hat auch dunkle Seiten“. Dies klingt jetzt, aus heutiger Sicht, natürlich fürchterlich banal, ich weiß, aber damals war es eben so: vom wohl behüteten Prinzen zum haltlosen Pubertierenden ohne Plan und Zukunft.
Egal, meine Pubertätskrisenzeit interessiert wohl eher niemanden da draußen - ich fühle mich als Vater von zwei pubertierenden Söhnen derzeit nur viel öfter als erträglich an diese Zeit damals zurück erinnert. Leider gelingt es mir überhaupt nicht, der Vater für meine Söhne in dieser so schwierigen Zeit zu sein, der ich so gerne sein möchte. Ich nehme mir ihre Worte und Emotionsausbrüche immer wieder sehr zu Herzen und zerbreche dann meistens selbst daran, anstatt ihnen eine starke Schulter zu leihen und innige Umarmung zu geben. Ich habe meistens das Gefühl, ich muss noch mehr als sie unter den Umständen leiden, damit sie weniger zu leiden haben. Oder anders gesagt: ich muss noch lauter schreien, damit sie ihr meist tränenreiches Geschrei beenden. Was für ein Irrglaube… Mein größtes Problem ist heute als Dreiundvierzigjähriger und dreifacher Familienvater, dass ich als Kind keine Konfliktbewältigung lernen konnte oder musste. Ich verliere immer sofort die innere Fassung und fühle mich, als würde die Welt wahrlich zusammenbrechen. Ja, mir fehlt nach wie vor der Halt und Boden unter den Füßen, wenn es Konflikte zu lösen gibt. Meistens ziehe ich mich nach dem Eklat in mich zurück und brauche wieder einige Tage, bis ich wieder ansatzweise so funktioniere, wie es der fordernde Alltag von mir verlangt.
Nun gut, weiter in der Geschichte von heute. „Siddharta“ von Hesse war also meine Buddhistische Grundsteinlegung und eine der ersten selbständigen Taten, als ich als Volljähriger nach der Matura nach Wien zog, war es, aus der katholischen Kirche auszutreten. Die Belehrung von einem Wiener Pfarrer in meiner damaligen, ersten eigenen Wohnung, werde ich wohl nie vergessen können, so dermaßen absurd verlief diese, bekräftigte aber voll und ganz meine Entscheidung. Ich wollte meinem Interesse für den Buddhismus weiter folgen - mich interessierte dabei aber kaum die Religion dazu, sondern die Philosophie dahinter, ja die Geschichte des Buddhas und deren Anwendbarkeit im eigenen Leben. Ich vollzog demnach ein Selbststudium, wie in so vielen Bereichen in meinem Leben bisher. Ja, ich bin de facto lieber ein intensiver Autodidakt als ein Streber, der sich von irgendwem vorgekautes Wissen reinzieht. Deshalb studierte ich damals auch nicht lange Politik, Theater und Publizistik, sondern ging meinen eigenen Weg ins Unbestimmte weiter.
Und bevor ich euch und mich jetzt noch länger mit pubertären Einblicken malträtiere, mache ich jetzt einen großen Sprung auf der Zeitachse meines Lebens nach vorne und zwar bis ins Jahr 2014. Nach jahrelangen Gesprächen mit den unterschiedlichsten spirituellen Lehrern, beschloss ich damals, als frischer Heimkehrer aufs Land, erstmals ein paar Tage in einem Buddhistischen Kloster zu verbringen. Ein Freund aus Vorarlberg erzählte mir zu Wiener Zeiten einmal von einem Tibetischen Buddhismus Kloster in Frastanz bei Feldkirch in Vorarlberg. Und dort zog es mich eben dann hin. Ich schaufelte mir den familiären Rücken für ein paar Tage irgendwie frei, schnappte meinen Mut und setzte mich in meinen Landrover Defender in Richtung Vorarlberg. Finanziell ging es mir damals ziemlich gut, hatte ich doch einige schöne Musik-Ausschreibungen beim ORF gerade gewonnen und auch das Produzieren und alles rundherum lief ganz gut. Innerlich fühlte ich mich abermals ausgelaugt und leer. Diese Leere immer wieder mit ein paar Bieren zu füllen erschien mir schon damals als der nicht richtige Weg.
Dort angekommen, nach einer wunderbar entspannten Anreise mit meinem Landy (den ich heutzutage echt vermisse…) wurde mir schnell klar, dass dies jetzt eine komplett neue Erfahrung werden würde. Ja, ich hatte Angst und wollte eigentlich sofort wieder umkehren und nach Hause zu meiner Familie fahren. Die Panikattacke am Parkplatz, noch im schwarzen Pickup sitzend, ist für mich negativ legendär - fast schon so gut, wie vor meiner ersten Reise nach Los Angeles, alleine damals am Gate vorm Abflug am Wiener Flughafen. Ja, auch solche fürchterlichen Momente vergisst man nicht. Oder mein Hirn zumindest.
Dennoch stieg ich aus, nahm meine Tasche und ging zu Mönch Helmut, mit ihm hatte ich zuvor geemailt und mir ein Zimmer im Kloster bestellt. Helmut war und ist ein Hiesiger, ja Österreicher. Ein Tibetischer Buddhist mit österreichischem Gesicht. Ruhig, souverän, liebevoll, distanziert. Und damals geschätze 60 Jahre alt. Seine Wortwahl karg, aber klar und direkt. Ein paar Sätze später fand ich mich in meinem Zimmer wieder. Holzboden, ein großes Fenster zum Garten, ein Holzbett, ein Holzkasten, ein kleiner Holzschreibtisch, ein selbstgeflochtener Vorleger, ein kleiner Holztisch, ein einfacher Holzsessel und ich - quasi ein Holzkopf mit seiner kleinen Tasche. So stand ich da. Ohne Handy, ohne MacBook, ohne Fernseher ohne nix. Einfach nur ich, auf 15 Quadratmetern Stille. Ich setzte mich aufs einfache, aber grandiose Bett - überzog die Decke und den Polster mit frisch gewaschenem und herrlich riechendem Bettzeug und begann sogleich in mein Notizbuch zu schreiben. Es sprudelte aus mir heraus wie schon lange nicht mehr. Viel mit mir selbst Ungeteiltes, aber Gefühltes hatte sich aufgestaut und ich dachte, wann wenn nicht jetzt und hier mal wieder meinem Inneren freien Lauf lassen.
Am Weg zu meinem Zimmer neben der Waschküche und dem, mit den Tibetische Mönchen geteilten Badezimmer, beobachtete ich einen etwas dickeren, kleinen Tibeter in seiner weinroten Kutte mit orangenem Umhang dabei, wie er auf einem steinernen Weg auf Zehenspitzen in seinen einfachen Ledersandalen versuchte, dort krabbelnde Ameisen nicht zu zertreten. Erst beim ersten gemeinsamen Abendmahl erkannte ich, dass dieser kleine Mönch unser Koch war. Als ich den Speiseraum nach mehrstündigem Schreiben erstmals betrat, ging dieser geradewegs auf mich zu und sagte statt hallo: „Punch my belly as hard as you can“. Ich verweigerte als Mimose und Pazifist natürlich sofort und antwortete leicht verlegen grinsend mit einem schlichten „No.“. Er wiederholte sich und bestand aber darauf. So gab ich ihm einen zuerst zaghaften, ihn zum Lachen bringenden Fauststoß in die Magengrube. Er ließ nicht locker und verlangte von mir, noch stärker zuzuschlagen. Ich boxte ihm nochmals gegen die Bauchdecke und staunte, wie hart er diese anspannen konnte - er lachte wieder schallend laut auf Tibetisch, begleitet von den Worten „You see, my b elly is as hard as wood.“ und ging zurück in die Küche, um für die versammelte, bei Tisch sitzende Schar an Mönchen und Gästen seine frisch gekochten Mahlzeiten zu holen. „Die Habens echt a bissl mim Holz hier…“, dachte ich und begann nach dem von den Mönchen vorgetragenen Tischgesang, die liebevoll zubereitete Suppe zu essen. Danach gabs ein Stück Bergkäse und Bauernbrot. Herrlich.
Aus dieser Zeit im Kloster könnte und denke, werde ich noch mehr erzählen in den kommenden Wochen. Heute möchte ich noch ein, dort statt gefundenes Treffen mit einem Fremden heraus zeichnen. Dort waren es ja eigentlich ausschließlich schöne und auch schräge Begegnungen mit mir bisher Unbekannten - aber eine davon war ganz speziell:
Zu dieser Zeit damals horchte ich gerne die Musik von Bob Dylan. Diese hatte ich zu Los Angeles Zeiten auf den unzähligen, stundenlangen Fahrten auf irgendwelchen Freeways entdeckt und bin auch bis heute dabei geblieben. Nicht alles, aber einige Alben und Songs gehen mir immer sofort und direkt unter die Haut. Ja, die Vibes des Bob Dylan haben es mir angetan. Auch am Weg nach Frastanz ins Kloster hörte ich im Landrover das Robert Zimmerman Album „New Morning“. Nach dem ersten Frühstück im Tibeterkloster ging ich raus in den wunderschönen Garten, setzte mich mit meinem Notizbuch in die Sonne, meditierte und trank schlückchenweise Tee. Plötzlich setzte sich, wie immer aus dem Nichts, ein ca. 65 jähriger Mann zu mir und begann sogleich mit mir zu reden. Ja, er fragte mich mit Deutschem Akzent, warum ich denn hier sei, ich sähe ja nicht aus, als würde es mir schlecht gehen oder ich gar krank sein. Bei ihm sei es das Selbe und er sei auch pur aus Neugierde hier. „Ja, das sind wir wohl alle“, dachte, aber sagte ich nicht. Ich war in unserem zirka einstündigem Kennenlerngespräch so perplex und fast wie erstarrt deshalb, weil dieser kleine Deutsche exakt wie Bob Dylan aussah. Also nicht wie ein Möchtegern-Lookalike, sondern von Natur aus eins zu eins. Nur mit dem Unterschied, dass er Deutsch sprach und noch nie einen Song geschrieben hatte. Nein, ganz anders: Er war zeitlebens Betreuer in einer Einrichtung für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, frisch pensioniert und ebenfalls erstmals in einem Buddhistischen Kloster. Sein ganzes Leben lang, wollte er schon mal diese Erfahrung machen und Zeit mit Menschen verbringen, die ihr Leben dieser so wertvollen Lebensphilosophie verschreiben und widmen. Im Unterschied zu den bisher in den letzten zwei Wochen nacherzählten „Meetings with a stranger“, konnte ich in diesem Fall sogar seinen Namen erfahren. Er hieß Klaus und war ebenfalls wie ich ein Familienvater. Er am Beginn seines Lebensabends und ich gefühlt mitten drin im Leben, aber dennoch irgendwie nicht angekommen. Ich hatte alles, ja vieles bereits Gewünschtes und Erträumtes vorzuweisen - Familie, Erfolg, Geld, Freunde, Gesundheit und schon vieles erlebt. Dies stellte ich auch Klaus so vor und er staunte ob meinem Alter, damals 35, was ich schon alles erreicht hatte.
Und dennoch fühlte ich mich leer, stets auf der Suche nach Fülle und Erfüllung. Und genau in dieser Leere und Einfachheit, dort im Kloster fand ich etwas, was mir immer wieder fehlte. Ich lauschte den Mönchen bei ihren Gebeten und Gesängen, ich suchte meine eigene innere Stille auf. Ich meditierte täglich Stunden und liebte den Zustand, wach, aber innerlich still sein zu können, ohne Lärm von innen wie von außen. Die stundenlangen Gespräche mit Klaus werden mir wohl auch für immer in Erinnerung bleiben. Wir blieben sogar noch eine Weile als Brieffreunde im Kontakt, doch irgendwann verlief dieser Austausch im Sand der Ewigkeit. Ich befürchte, Klaus ist irgendwann mal gestorben - leider weiß ich dies nicht genau. Und Totgesagte leben bekanntlich länger. Ich wünsche es ihm.
Ich werde diese Tage in der Sommersonne, in den Bergen, im Kloster wohl nie vergessen können. Auch die Art und Weise, wie lange und intensiv man sich mit jemandem, den man gerade erst kennenlernen durfte, unterhalten und austauschen kann, begeisterte mich zutiefst. Es war so unbeschreiblich schön menschlich, dass es mich auch heute in der Erinnerung noch zu Tränen rührt. Wir sind so schöne Wesen - in unserer Essenz sind wir wahrlich von, ich wage es zu sagen, göttlicher, ja magischer Natur. Dies sehe ich auch tagtäglich in so vielen Menschen, allen voran meinen drei Söhnen, egal ob sie nun pubertieren oder sich im nächtlichen Bett zu mir kuschelten. Sie sind in ihrer Essenz, ja in ihrem Sein das wohl schönste Geschenk, das man im Leben erfahren darf. Ja, ich gehe sogar noch weiter und sage abschließend für heute: Das Leben an sich, ist das schönste Geschenk. Wir haben nur verlernt, das Leben und leben dürfen an sich, als größtes Geschenk zu erkennen und zu pflegen. Ich wiederhole mich: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
MEETING WITH A STRANGER - DREI BEGEGNUNGEN DER BESONDEREN ART (Teil 2): „Mit dem Fahrrad in die Freiheit“.
Seit vielen, vielen Jahren schon sammle ich Kraftorte da und dort. So wie damals in Kalifornien und Wien auch hier in meiner neuen, alten Heimat Aschach an der Donau. Eigentlich unglaublich, dass wir schon seit acht Jahren hier am Land leben, die Zeit verfliegt, aber darum gehts heute nicht. Heute möchte ich euch eine weitere Geschichte zum Thema „Meeting with a stranger“ erzählen. Und dieses zweite Treffen mit einem Fremden fand eben an einem meiner Kraftorte hier entlang der Donau vor geschätzten sieben Jahren statt. Ich war quasi noch neu hier in meiner neuen, alten Umgebung und hatte meine Fühler und Sensoren in alle Richtungen nach sogenannten Kraftorten ausgestreckt und aktiviert. Warum auch immer, aber Kraftorte, also Orte an denen man für eine gewisse Zeit nur für sich selbst sein kann und in der Natur die Stille findet, suche und finde ich schon mein ganzes Leben. Als Kind war einer meiner Lieblingskraftorte, wie schon erwähnt in einer meiner Geschichten, die Baumkrone vom höchsten Ahornbaum am wildromantischen Teich-, Wald- und Steinbruchgrundstück meiner Eltern. Die vielen Momente dort oben im Sommerwind sitzend kann ich zu jeder Zeit innerlich abrufen, als wäre ich erst gestern frisch erholt und entspannt wieder runterklettert ins Leben, ja in den Alltag hier unten. In Kalifornien zum Beispiel suchte ich immer wieder gerne einen Felsen auf einem kleinen Strandabschnitt namens „Broad Beach“ im nördlichen Malibu auf. Durch Santa Monica und Malibu durch fahren Richtung Norden und dann bei der Ampel neben dem Trancas Supermarket halb links in die kleine Wohnstraße einbiegen - für jene von euch, die sich vor Ort auskennen. Dort saß ich dann gerne, vor allem, wenn mir das LA Theater mal wieder zu viel wurde, im Schneidersitz am Felsen, lauschte dem Pazifik und versuchte im Rhythmus der Wellen zu atmen. Dies am liebsten ein bis zwei Stunden lang - einatmen, Gedanken fokussieren und konzentrieren - ausatmen und die Gedanken wie Müll ins Universum raus blasen. Bis die Stille eintritt, ja das Wachsein ohne zu denken. Leben im Jetzt ohne der permanenten Störgeräusche von außen wie von innen. Ein Ozean wie der Pazifik eignet sich ideal für solche Stille Sitzungen - er fehlt mir auch ein bissl, muss ich zugeben. Die Kraft und Macht des Pazifiks ist unglaublich groß und intensiv. In Andalusien, meinem Winterzufluchtsort der letzten Jahre, sitze ich gerne am Mittelmeer - dort ist es auch menschenleer und sehr schön - die Energie des Mittelmeeres kann man mit seinem großen Bruder aber summa summarum nicht vergleichen.
Einmal saß ich noch weiter nördlich von Malibu an einem der endlosen Strandabschnitte ebenfalls im Schneidersitz auf Felsen, nur ca. 50 Meter von der Brandung entfernt. Wie von Geisteshand gesteuert blickte ich plötzlich auf und sah raus aufs Meer vor mir. Ich traute meinen Augen nicht und saß wie versteinert mit runtergefallenem Kinn da: Ganz nah an der Brandung tauchte völlig wie aus dem Nichts ein riesiger Buckelwal auf - ich hatte bis dahin noch nie einen Wal in freier Natur erlebt - mir stockte der Atem. Genau einmal atmete er sekundenlang mit hoher Fontäne aus, zeigte seinen riesigen, breiten Rücken, kurz sah mein ein Auge, dann noch die riesige Schwanzflosse und weg war er wieder. Und dies ganz nah am Strand, „Wie oft im Leben kann so etwas bitte passieren?“, dachte ich und blieb mit Tränen der Rührung und Dankbarkeit in den Augen noch eine Weile sitzen. Einfach unvergesslich und unbeschreiblich. Einer der schönsten Momente meines Lebens.
Dies könnte man natürlich jetzt auch als „Meeting with a stranger“ bezeichnen - die Begegnung meiner Geschichte von heute hat aber abermals mit einem fremden Menschen zu tun und nicht mit diesem Koloss des Ozeans. Manchmal frage ich mich, wo dieser Buckelwal in diesem Moment gerade ist und ob er überhaupt noch lebt oder schon längst irgendeiner menschlichen Untat zum Opfer gefallen ist… M anchmal beim Meditieren denke ich an meinen Wal von damals und versuche mir vorzustellen, wie er gerade irgendwo in diesem unvorstellbar großen Ozean schwimmt, taucht, auftaucht und atmet. Vielleicht war es ja damals seine erste Begegnung mit einem Menschen - da ich sein Auge sehen konnte, hat er mich vielleicht ja auch wahrnehmen respektive sehen können. Who knows? Vielleicht fragt er sich ja auch manchmal wo der kleine, sitzende, weinende Mann von damals gerade wieder sitzt und übers Leben sinniert. Naja, Spaß beiseite.
Auch in Wien hatte ich so meine Kraftorte. Die Jägerwiese Lichtung im Wienerwald vom Cobenzl aus zu Fuß aufgesucht, zum Beispiel. Immer wieder mal in der Wiese liegend, zum Himmel starrend, dem Wind in den Blättern der Bäume lauschend. Ja, auch das hatte was. Egal, nun weiter im Text, ja mit der eigentlichen Geschichte von heute - jetzt hab ich mich fast ein wenig verzettelt und so viel Zeit wie ich gern hätte, habe ich heute nicht für meine neue Geschichte - ich arbeite gerade an einer zeitintensiven Filmmusik und am Nachmittag bringe ich Menschen unterschiedlichstem Alters wieder das Tennisspielen bei - wie es dazu kam ist eine andere Geschichte und mir selbst oft immer noch ein kleines Rätsel, welch Wendungen das Leben, ja die Fügung oft mit sich bringen kann.
Einer meiner schönsten Kraftorte hier an der Donau befindet sich ca. fünf Kilometer stromaufwärts oberhalb des Donaukraftwerkes Aschach am linken Donauufer. Dort endet der Radweg und mündet in einen Klettersteig und Wanderweg. Ein kleiner Bach mit meist glasklarem Wasser mündet neben einem steilen Felsen in die Donau und neben diesem Bach steht mit Blick zum großen Strom eine Holzbank. Meistens laufe ich dorthin, um zu rasten und zu genießen. Es ist für mich ein Ende der Welt, auch wenn ich weiß, dass es dahinter weitergeht.
An einem Sonntag vor ca. sieben Jahren, schätze ich, lief ich wieder im Rahmen eines sonntäglichen Morgenlaufes zur Bank am Bach bei der Donau. Dort angekommen, setzte ich mich hin um zu meditieren, ja um ein paar Augenblicke lang still zu sein. Weit und breit keine Menschenseele in Sicht - herrlich. Doch plötzlich, wie so oft im Leben, änderte sich alles und ein weißhaariger, älterer Herr kam wie aus dem Nichts auf seinem schon etwas älter aussehenden Fahrrad auf mich zu, stoppte beigleitet von den Worten „Guten Tag“ vor mir, stieg ab und setzte sich direkt neben mich auf die Bank, als wäre es das Natürlichste auf der Welt und wir beide schon ewig Freunde.
Mir war sofort unwohl und ich dachte mir „Was soll das denn jetzt wieder werden?“. Es regte mich sofort immens auf, dass dieser Fremde sich einfach ohne zu fragen, hier irgendwo im Nirgendwo zu mich setzte und schwieg. Ja, wir beide schwiegen uns für einige Momente gekonnt und hartnäckig, ja ausdauernd an. Er schwieg in meine Richtung und ich schwieg zurück. Ich fühlte mich plötzlich wie ein Druckkochtopf dessen Wasser schön langsam zu kochen begann, ließ mir aber partout nichts ankennen. Eigentlich wollte ich nach ein paar Minuten einfach aufstehen und kommentarlos das Nichtgeschehen verlassen. Genau als ich im Begriff war mich zu erheben sagte er: „Schön ist es hier“ mit ostdeutschem Akzent. „Ja“, erwiderte ich, mit leicht saurem Unterton. „Sie haben ein KTM Fahrrad. KTM Fahrräder sind gute Fahrräder. Meines ist schon über dreißig Jahre alt.“ Fuhr er fort und zeigte entspannt auf seinen gepflegten, aber alten Drahtesel. „Es hat mich schon weit getragen, tausende Kilometer, Jahr für Jahr - immer angetrieben von meiner eigenen Muskelkraft. Auch bis hierhin. Wie geht es hier eigentlich nun weiter?“ fragte er mich. Und genau diese Frage hatte ich auch gerade im Sinn, nur mit dem kleinen Unterschied, dass er den Weg meinte ich die Situation. Ich erklärte ihm mit etwas freundlicherem Unterton seine örtliche Position und welche Richtungen er nun einschlagen könnte, um von hier wieder weg zu kommen, ob zu Fuß, mit einer kleinen Fahrradfähre oder wieder zurück auf seinem KTM Rad. Er hörte mir aufmerksam zu und bedankte sich sogleich auf sehr freundliche Art und Weise. Und so kamen wir ins Gespräch. Zwei Männer, beide weiße Haare, einer alt und einer jung, auf einer Holzbank im Nirgendwo, an einem Sonntagmorgen, irgendwann in diesem Leben. Schräg.
Er erzählte mir sein halbes, einfaches, aber doch auch spannendes Leben. Er sei nun, nach dem Ableben seiner Frau und dem Ausziehen seiner Kinder wieder alleine unterwegs. Ja, das Unterwegssein hatte es ihm angetan. Mit gemächlichem Tempo die Welt erkunden. Stehenbleiben und staunen, wo auch immer er möchte. Er habe nicht viel Geld übrig, „aber wer nicht viel Geld hat, kann auch nicht viel verlieren“, meinte er weise und entspannt. Nach etwa einer Stunde des Gespräches, sahen wir die kleine Holzfähre auf der Donau zur naheliegenden Anlegestelle herankommen. Er wurde schneller in seinem Erzähltempo, wollte mir aber noch unbedingt erzählen, dass er 1989, in der Nacht des Mauerfalles, mit seinem weißen KTM (meines ist übrigens auch weiß) laut jubelnd und mit Tränen der Freude und Hoffnung nach Freiheit in den Augen in Berlin über die Grenze fuhr. Hin und retour, hin und retour - weil niemand mehr kontrollierte und unzählige Menschen feierten. Damals in dieser historischen Nacht beschloss er mit seinem Fahrrad weiter und weiter zu fahren, um die Welt hinter der Mauer kennen zu lernen.
Ich begleitete ihn dann noch bis zur bereits angelegten Fähre und lauschte seiner Berlin Geschichte. Er nahm sein KTM Rad, bestieg die Fähre, schaute mir in die Augen begleitet von den Worten „Tschüss, machs gut! Schau dir die Welt an! Sie ist schön!“. Die Fähre legte mit ihm als einzigen Fahrgast ab und fuhr langsam weg. Ich winkte ihm nach, als würde ein alter, vertrauter Freund auf Reisen gehen. „Absurd, völlig absurd!“, dachte ich. Völlig aus dem Nichts. Gerade saß ich noch alleine da, mit mir und meinen Gedanken, Ängsten und Sorgen beschäftigt. Eine Stunde später war alles anders. Irgendwie verwirrt und perplex ob der Geschehnisse, lief ich wieder zurück zu meinem Auto und vollendete meinen sonntäglichen Zehnkilometermorgenlauf. Immer wieder, wenn ich zu diesem Kraftort jogge oder mit dem Rennrad fahre, muss ich an dieses Treffen mit einem Fremden denken. Er kam aus dem Nichts und verschwand wieder dorthin. Irgendwie magisch, finde ich bis heute. Wir sind alle nur Menschen, klingt pathetisch, aber es ist und bleibt so. Ich bin und bleibe dankbar für solche Geschenke der Fügung. Und ich bleibe dabei: Wenn der Mensch schon Jäger und Sammler ist, dann sollte man sich tagtäglich auf die Suche nach freudvollen, ja besonderen, wertvollen, schlicht schönen und lebenswerten, ja liebevollen Momenten machen. Ich wiederhole mich: Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
MEETING WITH A STRANGER - DREI BEGEGNUNGEN DER BESONDEREN ART (Teil 1): „Mr Batman“
Heute möchte ich mal über etwas ganz Anderes schreiben und sprechen: Über die Begegnung mit Fremden. Ich meine damit aber nicht primär die alltäglichen Kurzbegegnungen mit fremden Menschen an der Supermarktkassa oder an der Tankstelle, sondern diese seltenen, speziellen und auf ihre Art und Weise fast schon magischen Momente mit fremden Personen, mit denen man an speziellen Orten eine gewisse Zeit verbringt und dabei ins Gespräch kommt, ja einen unerwarteten Dialog führt.
Ich sage ja gerne und seit geraumer Zeit, ja bereits seit vielen Jahren immer wieder „Alles ist Fügung“ und zeitlebens, Tag für Tag gilt es der Fügung das eigene Vertrauen zu schenken. Klingt banal und für viele da draußen wohl wieder zu esoterisch - für mich ist es eine tägliche spirituelle Übung. Oder wie Byron Katie, ja die Erfinderin von „The Work“, gerne mit ihren Worten sagt: “Life is simple. Everything happens for you, not to you. Everything happens at exactly the right moment, neither too soon nor too late. You don't have to like it... it's just easier if you do.”
Gerade in Zeiten wie diesen, wo man tagtäglich mit unzähligen Störgeräuschen, ja Permanentlärm in Form von Kriegsbedrohung, Atomkrieg vor unserer Haustür, Lebenskostenexplosionen bei gleichem Umsatz bzw. Gehalt, usw., von außen belastet und zugedröhnt wird, ist es beinahe utopisch der Fügung oder eben dem Lauf des Lebens das Vertrauen zu schenken. Ein Satz wie „Alles wird gut“ klingt derzeit in meinen Ohren wie eine realitätsverweigernde Verarschung, sei er auch noch so liebevoll gemeint. Ich habe vor ein paar Wochen beschlossen, nur mehr maximal einmal pro Woche die Nachrichten im Fernsehen zu konsumieren - ja, Medienfasten ist angesagt. Auch den ganzen Müll in den sogenannten sozialen Netzwerken möchte ich mir am liebsten ersparen - mir reicht es völlig, mit dem Alltag an sich zu leben und den Fokus auf die raren aber lebensnotwendigen freudvollen Momente nicht zu verlieren.
Dass ich seit letzter Woche auch einen TikTok (ich nenne es bezeichnenderweise lieber FikFok) Account habe, hat marketingtechnische Gründe rund um mein neues Album. Klassische Werbekanäle wie Radio, Zeitschriften oder TV sind mehr oder minder obsolet geworden und so werde ich meine Musik und meine Inhalte, ja meinen sogenannten Content auch in den sozialen Kanälen fortan anteasern müssen. Ich werde versuchen, mir einen Spaß daraus zu machen - dass ich mich in diesem Umfeld wie ein alter Sack oder gar eingebürgerter Alien fühle, ist ein anderes Thema und wie es mir dabei ergeht, interessiert per se niemanden. Hier in meinem Podcast kann ich allerdings sagen und schreiben wonach mir gerade ist. Hier an dieser Stelle werde ich niemals einen Filter zulassen - egal, ob es wem schmeckt oder nicht.
Zurück zum heutigen Thema meines kleinen Podcast Aufsatzes. Ich möchte euch drei kurze Geschichten über drei kurze, aber unvergessliche Begegnungen und Gespräche mit Fremden erzählen. Drei Fügungen an den unterschiedlichsten Orten, die mich jeweils sehr überraschten, wie aus heiterem Himmel fielen und mich sehr bewegten und in weiterer Folge auch prägten.
Die erste Begegnung trägt für mich den Titel „Mr Batman“ und geschah 2011 in meiner damaligen Wahlheimat Los Angeles. Es waren ganz spezielle Tage für mich damals. Erstmals durfte ich in einem der wohl bekanntesten und renommiertesten Tonstudios der Welt ein paar Songs aus meiner Feder aufnehmen: in den Ocean Way Studios in Hollywood. Damals hießen sie bereits EastWest Studios, umbenannt nach und von einer großen Sample Library Firma, die diesen musikhistorischen Ort gekauft und vorm Untergang gerettet hatte. Die Zeiten hatten sich eben auch schon damals geändert und große, teure Studios brauchte schon damals fast niemand mehr, da die technologische Entwicklung in der Musikproduktion mittlerweile wohl jedem erlaubt, von zuhause aus Musik für die Welt da draußen zu generieren. Da ich aber schon immer ein großer Fan von echter, handgemachter, selbst aufgenommener Musik war und bin, wurde damals ein Traum für mich wahr. Ja, ich lebte für ein paar Tage einen meiner Jugendträume - jenen, mit meiner Musik raus in die Welt zu gehen. Der kleine, groß gewachsene Axel aus Aschach an der Donau, der einst von der großen Tenniswelt träumte, plötzlich als geschätzter und damals fleißig im US Radio gespielter Singer-Songwriter mit einem sehr respektvollen Produzenten, Bernie Penzias, und einem seiner absoluten Lieblingsschlagzeuger, Butch Norton von The Eels, an seiner Seite im Studio 2 der Ocean Way Studios. Inklusive einem sehr netten und kompetenten Studioassistenten und all dies nur ein paar Tage nach den Red Hot Chili Peppers. Der Yamaha Flügel der Chili Peppers war noch nicht abgeholt und so durfte ich zu meinem Song „Hooray“ (eine Liebesballade für Athena) das Klavier auf diesem großen Tastending einspielen - ich kann mich noch genau erinnern, dass ich von der unbeschreiblichen Akustik in diesem großen aber unglaublich direkt und trocken klingenden Raum sehr angetan war und mir bei den ersten Takes die Finger zitterten. Auch die Leadvocals zu diesem, wie ich finde, schönen Song sang ich im Ocean Way Studio 2. Auch dies war eine unvergessliche Geschichte, da mich Ben, der Tonmann vor Ort, vorm Einsingen fragte, in welches Neumann U47 ich denn singen möchte - ich entscheid mich dann für das intern „Frank Sinatra 47“ genannte Mikrofon - jenes aus 1954, welches sie für zahlreiche Sinatra Gesangsaufnahmen verwendeten. Welch große Ehre, dachte ich und es klang auch wirklich richtig gut durch das alte, geniale von Rupert Neve selbst gelötete Mischpult - übrigens das Lieblings-Mischpult von Rick Rubin, (Produzent von u.a. Tom Petty, Chili Peppers, etc.).
Auch Butch, der Schlagzeuger, war für mich im realen Leben bis zu diesem Tag ein Fremder - ich kannte und schätzte ihn bisher nur von seinem Drumming mit und für die Eels, eine meiner Lieblingsbands nach der Grunge-Ära. Und auch die erste Begegnung mit Butch bleibt für mich unvergesslich. Ich parkte meinen PT Cruiser am für mich mit den Worten „Reserved for Mr Wolph“ handgeschriebenen Zettel reservierten Parkplatz hinter dem Studio 2 und sah Butch bereits seine Drumsets und sein ganzes Zeugs ins Studio rein räumen. Er ging mit ausgestrecktem Zeigefinger und seinem typischen Stetson Cowboyhut und dunkler Miene auf mich zu, ich öffnete das Fenster, er zeigte mir mit zehn Zentimeter Abstand ins Gesicht und sagte statt hallo: „I see, you are one of those guys!“ Und ging wieder weg. Ziemlich irritiert stieg ich aus und fragte ihn: „Do you need a hand?“. Er blieb bei seiner dunklen Miene und erwiderte „Sure, I do need a hand.“ Ich schnappte eine seiner wunderschönen und alten Slingerland Bassdrums und ging ihm sofort nach. Plötzlich blieb er stehen, drehte sich um, umarmte mich und sagte: „Hi Axel, great meeting you, love your songs.“. Wieder stand ich da und wusste kaum wie mir geschah, bedankte mich aber höflichst für seine lieben Worte und hilf ihm weiter das ganze Zeugs ins ehrwürdige Studio, errichtet vom legendären Bill Putnam, zu tragen.
Die Aufnahmesessions verliefen schlicht großartig - Butch ist ein absolut liebenswerter Mensch und grandioser, sehr gefühlvoller und kreativer Musiker, Schlagzeuger und Percussionist. Ja, sein Humor ist einzigartig und selten musste ich neben der hochkonzentrierten Arbeit so viel beim Musikmachen lachen. Unzählige Male dachte ich, „Das hat er jetzt aber nicht wirklich gesagt?!?“. Ein kleines Beispiel: Bei meinem Song „Orchids“ spielte er nach seinen Drums auch einen Shaker ein. Aber eben nicht irgendeinen handelsüblichen Shaker, sondern eine Art doppelter Glasvase mit Glaskugeln drinnen. Als er also gerade am Shaken mit seinem Shaker war, fragte ich ihn zwischen zwei Takes über das Talkback, was er denn da in den Händen haltet? Wie aus der Pistole geschossen sagte er: „You want me to tell you what this Shaker is all about? Really? Well, this is iced sperm from my dad and it sounds really nice.“ Tja, vereistes Sperma seines Vaters, was soll man da noch sagen…
Die Art und Weise, wie mich das gesamte Studio Personal behandelte, war ebenfalls unvergesslich - kein fühlbarer Unterschied, ob Anthony Kiedis oder ich etwas brauchten oder im Studio-Komplex sinnierend und singend herum gingen - wenn auch typisch amerikanisch oberflächlich, aber doch ein schönes Gefühl, so viel Respekt zu erfahren. Da könnte man fast schon glauben, man wäre wer Besonderer.
Nun aber zum „Meeting with a stranger“ von heute, die restlichen beiden Treffen mit Fremden erzähle ich euch in den kommenden zwei Wochen, heut gehts zuerst Mal um „Mr Batman“:
Am frühen Abend nach den Aufnahmesessions mit Bernie, Butch und Ben im legendären Ocean Way Studio, fuhr ich hungrig und ziemlich erledigt von den vielen Stunden intensivster Studioarbeit zu einem meiner Lieblingsorte in Los Angeles, dem Farmers Market auf Fairfax Avenue. Quasi ein Wiener Naschmarkt auf Kalifornisch. Dort zeigte mir mein Freund und ebenfalls Langzeit-Drummer Mario einst, ich denke, es war 2004, einen Französischen Crêpes Stand. Ein kleines rundherum offenes Lokal mit einer großen Auswahl an süßen und sauren Crêpes - nicht ganz so gut wie in Paris selbst, aber doch lecker und ein kleines Stück Europa für mich immer wieder im verrückten Los Angeles. Deshalb fuhr ich gerne dorthin und verbrachte ein paar Augenblicke in einer mir irgendwie vertrauten Umgebung, war ich doch zu Hause in Wien ein regelmäßiger Besucher des Naschmarktes - die Gerüche, die Aromen, die Leckereien, die Vielfalt, mein Notizbuch und ich. Da wir dort - ein Lebenselixir für mich seit jeher. Nur hier in Aschach hat sich diese für mich so wertvolle Aus- und Denkzeit de facto über die letzten paar Jahre in Luft aufgelöst. Aber dies ist wahrlich eine andere Geschichte.
So saß ich dann also an diesem aufregenden und auch fordernden Studiotag wieder auf nem Barhocker an der Crêpes-Bar am Farmers Market und bestellte mir irgendeine saure Crêpe. Plötzlich kam ein alter weißhaariger Mann, im gepflegten, weißen Vintage-60s-Style-Anzug heran spaziert und setzte sich genau auf den Barhocker neben mich. Es sei erwähnt, dass ich mit zwei weiteren Gästen zu diesem Zeitpunkt ziemlich alleine war und der ca. 80 jährige Greis auch irgendeinen anderen Hocker hätte nehmen können. Sobald er saß, begann er mit der überschminkten Kellnerin hinter der Theke zu sprechen und zu flirten. Aber nicht billig und aufdringlich, sondern in einem gewissen vornehmen, britischen Stil. Man könnte fast schon wertschätzend aufdringlich dazu sagen. Ich fühlte sofort ein gewisses Fremdschämen, war doch aber gar nicht in deren Konversation involviert - meine Empathie kannte aber schon damals wohl keine Grenzen. So grinste ich, mich unbemerkt fühlend, etwas mit und ja, seine flirt jokes waren wirklich von großer Schule.
Mein Look an diesem Tag war auch anders als heutzutage: Karierte, graue Hose, schwarzes Sakko, Pornostyle Kipferl-Schnurbart, riesige 70s Plastik Designbrille, Tweedhut und funky braunorange Nike Sneakers. Plötzlich, offensichtlich angetan von meinem Style drehte sich der pensionierte Flirter zu mir her und eröffnete das Gespräche mit den Worten: „I dig you style, boy, looks funky, dude. How’s your singer-songwriter life goin’?“ Ich verschluckte mich ob seiner Spontanität beinahe und antwortete „Thanks you sir, all is well - just had a great day, thank you.“ Ungebremst und frei drauf los redete er weiter. „You know boy, music is my life. I was a bass player, arranger and film music composer my whole life. I worked my ass off at places such as Ocean Way Studios and many more…“. Er erzählte mir in einem packenden Kurzreferat quasi seine halbe Lebensgeschichte. Er kam vor einigen Jahrzehnten ebenfalls wie ich aus Europa nach Kalifornien um mit seinem Können und seiner Musik raus in die Welt zu gehen und landete dabei eben als Bassist, Arrangeur und Komponist bei der damals so florierenden Filmmusik. Völlig unwissend meines vorangegangen Tages bis zum Treffen mit ihm, fragte er mich dann: „Have you ever been to Ocean Way?“, naiv ungläubig fragte ich, „You mean the legendary studios?“, „Yeah, sure“, legte er nach. Ich war irgendwie wie versteinert: „Habe ich mein Handeln und mein Sein dermaßen plakativ ins Gesicht geschrieben?“ fragte ich mich kurz zweifelnd selbst, gestand aber sofort die Fakten des Tages ein und sagte: „Yes, Sir, today was my first Day at the Ocean Way Studios, recording stuff for some of my new songs.“ Er lachte schallend laut und klopfte mir freundschaftlich auf meine Schulter, als hätten sich zwei alte Freunde gefunden, um jetzt gemeinsam einen drauf zu machen. Da man in Los Angeles aber immer sehr viel Zeit mit Autofahren verbringen muss, tranken wir nur eine Coke gemeinsam und tauschten uns weiter über Dies und Das und vor allem auch die Veränderungen seit seiner zu meiner Zeit aus. Packend, bewegend und tatsächlich wie ein alter Freund - ich sah mich selbst in ihm und er fand sich selbst offenbar auch wieder in meinen Worten und meiner Gestalt. Nach etwa einer Stunde - wir hatten mittlerweile schon zwei quasi Zaungäste, die neben uns saßen und aufmerksam mithörten und -lachten - sang er mir plötzlich lauthals, als wären wir alleine vor Ort, eine mir sofort bekannte Melodie vor... „Do you know this? Have you ever heard that?“ fragte er gleich nach. Klar kannte ich die Batman Titelmelodie und auch das gesungene „Batman!“ aus den wahrscheinlich Sechziger Jahren und sagte ihm das sogleich auch. Er strahlte bis über beide Ohren und fügte hinzu: „Well, boy, that was me! I wrote it, arranged it, played bass on it and sang it!“ Und sang es gleich nochmals für mich und die Zaungäste.
So plötzlich wie er erschien, fand unser Treffen auch dann wieder sein Ende. Er sah mir in die Augen begleitet von den Worten „You are a good man, I can see it in your eyes. Stay like this and follow your dreams. Only your heart knows what to do and where to go. Thanks for talking, I really appreciate it.“, bezahlte unsere Cokes und seine Crêpe, stand auf und ging leise vor sich hin summend und pfeifend wieder weg. Ich bezahlte auch und begab mich zurück zu meinem silbernen PT Cruiser.
Am Heimweg, den 101 rauf zum 5er Freeway, musste ich noch viel über all die Geschehnisse an diesem besonderen Tag nachdenken. Was für eine tägliche Geschichte war das denn!? Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass sich gerade solche besonderen Tage oftmals im Leben wiederholen werden, doch manchmal, wie auch soeben beim Schreiben darüber, begebe ich mich gedanklich in meiner Vorstellung wieder zurück an solche Tage und in solch bewegende Situationen, die mir meine Fügung einst schenkte.
Nächsten Dienstag geht es weiter mit einem weiteren „Meeting with a stranger“ und ich freu mich jetzt schon, euch bald davon erzählen zu dürfen. Diese Geschichten und Ausflüge in Erlebtes, ja besondere Lebensmomente finde ich gerade in Zeiten wie diesen sehr hilfreich - sie helfen mir den Fokus wieder auf freudvolle Momente zu richten, es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar.
(Portraiphoto by Nina Prommer)
NICHTS. ODER DER MANN DER FLIEHEN LERNTE.
Ich bin ein leidenschaftlicher, aber mittlerweile viel zu zu selten ausübender Angler. Schon seit Kindesalter jage ich nach dem großen Fang, könnte man fast schon metaphorisch behaupten. Auch diese Leidenschaft habe ich meiner wildromantischen Kindheit zu verdanken. Am Grundstück mit den hohen Ahornbaumkronen gab und gibt es nach wie vor einen kleinen Naturteich mit eigenen Quellen, Schilf, Schlangen, Fröschen, Fischen und allem was dazu gehört: Ein all-inclusive Kinder-Abenteuer-Park der Sonderklasse, nachhaltig, bio und zurück zur Natur pur - würde man heute wohl sagen.
Für mich und meine Freunde war es früher einfach nur „da Teich“. Und an diesem besagten Teich begann ich schon in jungen Jahren, zuerst mit selbstgebasteltem Pfeil und Bogen und etwas später mit einfachster Angel nach Karpfen, Rotaugen und Hechten zu angeln. Hier in meiner Heimat nennt man den Angler übrigens Fischer und nicht Angler. Ich suchte demnach schon im Bubenalter mein Fischerglück.
Über die Jahre hatte ich immer weniger Zeit um fischen zu gehen. Gerade als ich in Wien und Los Angeles lebte verschwand diese Leidenschaft beinahe zur Gänze aus meinem Leben. Erst vor ein paar Jahren legte ich mir eine neue Angler-Ausrüstung zu und begann immer wieder einmal mit meinen Söhnen fischen zu gehen. Alleine dieser Akt hat es mir mittlerweile wieder sehr angetan - diese wunderbare Zeit gemeinsam in der Natur mit meinen Söhnen - Vater-Sohn-Zeit deluxe sozusagen. Und am liebsten versuchen wir in einem winzigen, kleinen Ort an der Donau mit ca. 100 Einwohnern namens Untermühl unser Anglerglück. Untermühl ist für mich ein Ende der Welt. Hier steht die Zeit still. Hier verbrachte ich die schönste und entspannteste Zeit meiner Kindheit und Jugend. Meine Eltern besaßen damals ein schönes, nicht allzu großes aber auch nicht kleines Motorboot mit Kajüte und dieses war eben dort im kleinen Hafen stationiert. Die Sommermonate damals verbrachte ich meistens mit meiner Mutter zu zweit auf unsrem Boot in diesem kleinen Ort irgendwo im Nirgendwo. Für mich war es eine große, schöne und vor allem heile Welt. Märchenhaft, still, abenteuerlich und vor allem eines: entspannt. Auch dort fischte ich täglich nach dem großen Fang. Und es waren auch immer wieder mal schöne Fänge dabei - das stundenlange Sitzen mit leichter Spannung und voller Neugierde bedeutete mir damals schon mehr als das ganze hektische Theater rund um einen großen Fang. Mal ganz abgesehen vom Fische töten, ausnehmen, schuppen und allem was dazu gehört. Angeln ja, Fische fangen, eher nein.
Vor acht Jahren, an einem Sonntagmorgen, war es dann mal wieder endlich soweit: die Anglerausrüstung war gepackt, die Tageslizenz schon streberhaft am Vortag gelöst und meine älteren Söhne Laurin und Matti waren ebenso bereit wie ich, die große Mühl in Untermühl mit Hingabe leer zu fischen. Ja, so groß war die Vorfreude und Motivation.
Um sechs Uhr dreißig waren wir an einem unserer Lieblingsangelplätze kurz vor der Mühl-Donau-Mündung angekommen. Noch etwas frisch, aber ein wunderbarer Sommermorgen, ohne Hektik, ohne Menschen, nur Natur. Der Fluss, die Angelruten, ein kleines Frühstück, die aufgehende Sonne, zwei Söhne und ein entspannter Vater. Ach ja, und ein Biber, der neben uns gemütlich und ohne Angst vor Menschen peu à peu an seinem Bau zimmerte. Ja, eine Idylle - genau so mag ichs. Und so begannen wir auch unser Anglerglück zu versuchen. Eine Angelrute wurde mit einem sogenannten Blinker versehen und eine mit einem Schwimmer und einer Brotkugel am Haken. Ich kümmerte mich mit starrem Blick und großer Geduld um den Schwimmer und meine Söhne, damals fünf und zehn Jahre jung, zogen den Blinker durchs kalte, klare Wasser.
So vergingen ein paar Stunden. Ein paar ruhige, entspannte Stunden ohne einem einzigen Fang - ja, manchmal fingen meine Buben beim Auswerfen des Blinkers einen Baum oder beim Rausziehen einen schwimmenden Ast, aber Lebendiges blieb uns vorenthalten. Die Laune meiner Welpen wurde sukzessive schlechter - sie sehnten sich doch etwas mehr als ich nach einem großen Fang. „Papa, ich mag jetzt einen Hecht fangen!“ hörte ich vom Fünfjährigen immer öfter, meistens erwidert vom Zehnjährigen mit den Worten „ein Zander oder Wels wäre auch cool - es muss kein Hecht sein“. Ich dankte meinem Großen für seine Loyalität, bemerkte aber, dass ich mir schön langsam was einfallen lassen sollte, denn auch mein Brotknödel am Karpfen-Haken fiel immer wieder der leichten Strömung zum Opfer und wurde von Fischen schlicht ignoriert. Langeweile kam auf. Also, nicht wirklich bei mir, aber bei meinen Söhnen, ganz offensichtlich und vor allem hörbar. So entschied ich mich, den Schwimmer, ohne Köder ins Wasser zu werfen und half meinen Buben bei ihrem Vorhaben, einen Raubfisch an den Dreifachhaken zu bekommen. Wir änderten immer wieder unsere Einwurfpositionen, vermuteten da und dort den großen Fang. So konnte ich sie noch für eine weitere Stunde, es ging schon gegen Mittag, bei Laune halten.
Plötzlich änderte sich, wie so oft im Leben, alles. Ein schäbiger, angerosteter, weinroter VW Bus blieb genau hinter unsrem Anglerplatz stehen. Meine Söhne blinkerten und ich starrte auf den Schwimmer ohne Brotknödel fünf Meter vor mir in der Mühl treibend. Ich drehte mich um und sah die Aufschrift „Carp Hunter“, groß und laienhaft selbstfoliert am Profifischer-Campingbus stehen. Ein Mann mittlerem Alters, in seiner Erscheinung schäbig wie sein Bus stieg aus und schlapfte träge aber doch bestimmt in meine Richtung. Ungefähr einen Meter neben mir blieb er stehen und begrüßte mich mit der für die Region Mühlviertel typischen Begrüßung: „Seas“. Ich roch seinen sanften Biermundgeruch und grüßte freundlichst zurück mit einem schlichten „Servus“. Meine Buben sagten gar nichts und ließen mich mit dem Karpfenjäger alleine. Die der rudimentären Begrüßung folgenden Schweigeminuten waren an Spannung und Ungewissheit kaum zu überbieten. Ich saß da, starrte aufs Wasser und der Profifischer stand sich seinen Sack kratzend neben mir und schwieg zurück. Schön langsam bekam ich es ein wenig mit der Angst zu tun. Nicht, dass dieser in Camouflage-Kleidung overdresste Mühlviertler mir oder meinen Buben was antun würde, nein, sondern, dass er mir bald aus seiner Profession und Neugierde heraus Fragen stellen könnte.
Und so kam es: Plötzlich räusperte er sich kurz und sagte: „Und, geht wos?“, im Sinne von „Und, hast du heute schon einen Fisch gefangen?“. Leicht erleichtert antwortete ich spontan und mühlviertlerisch angehaucht: „Na, geht nix.“, im Sinne von, „Nein, ich habe heute noch keinen Fisch fangen können.“ Es folgte wieder minutenlanges Schweigen. Ich konnte beinahe seine Zahnräder im Hirn knattern und rattern hören. Kurz rülpste er ein wenig, dann schwieg er wieder. Und ich schwieg auch. Wieder bekam ich es leicht mit der Angst zu tun und hoffe, dass er mir nicht die eine, bestimmte Frage stellen würde. Und als ich noch am Hoffen war, stellte er sie mir: „Wos hostn drauf?“, im Sinne von „Welcher Köder hängt unter deinem Schwimmer da draußen am Haken?“ Mit dieser Fangfrage hatte er mich erwischt. „Was nun?!?“, dachte ich laut in mir. „Was sage ich jetzt?!?“ Ich sehnte mich nach Hilfe meiner Söhne, aber die hatten sich schweigend in Sicherheit gebracht und ließen mich mit dem Carp Hunter alleine. Ja, sie schienen wahnsinnig beschäftigt und waren für keinerlei Gespräch zu haben. Gerade eben noch permanent am Schwätzen, plötzlich die bravsten Kinder auf Erden. Jetzt hörte ich meine eigenen Zahnräder im Kopf rattern…“Axel, sag was!“, hörte ich immer lauter und sah mich gefangen, wie so oft im Leben, zwischen Wahrheit oder Notlüge. Und da ich zeitlebends immer emotional ehrlich sein möchte, sagte ich einfach: „Nichts.“, im Sinne von „Ich habe nichts am Haken angeködert.“
Die folgenden Minuten waren an Stille kaum zu überbieten. Und ich hatte glaskar den Eindruck, dass es der Karpfenjäger nun auch ein wenig mit der Angst zu tun bekam. Er wirkte irgendwie wie versteinert, rülpste und und kratzte sich nicht mehr. Dachte wohl, einen Irren in freier Wildbahn angetroffen zu haben. Er stand da, und schwieg. Ich hatte das Gefühl, auch er sehnte sich in diesem Moment ein wenig nach Hilfe von außen. Und so schwiegen wir uns von einander beängstigt noch ein paar Augenblicke an. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich war, als er dann plötzlich das Schweigen in der Natur brach: „Seas“, sagte er, drehte sich um, schlapfte zurück zu seinem Abenteuerfahrzeug, stieg ein und fuhr mit fast schon quietschenden Reifen davon. Weg war er. Er hatte die Flucht ergriffen und ich war wieder frei. Meine Söhne kamen wieder in meine Nähe und gaben sich interessiert: „Wer war das Papa und was hat er gesagt?“, fragten sie neugierigst. „Nicht viel“, antwortete ich. „Fast nichts“ hat er gesagt.
Der Hunger ließ uns unsere Sachen packen, zuhause warteten schon Mamas Schnitzel auf uns. Seither muss ich immer wieder an diese Situation an der Mühl in Untermühl denken. Ich hoffe für den Unbekannten, dass sich seine Angst vorm köderlosen Fischer, ja dem Verrückten mit dem Haken ohne irgendwas, mittlerweile wieder gelegt hat.
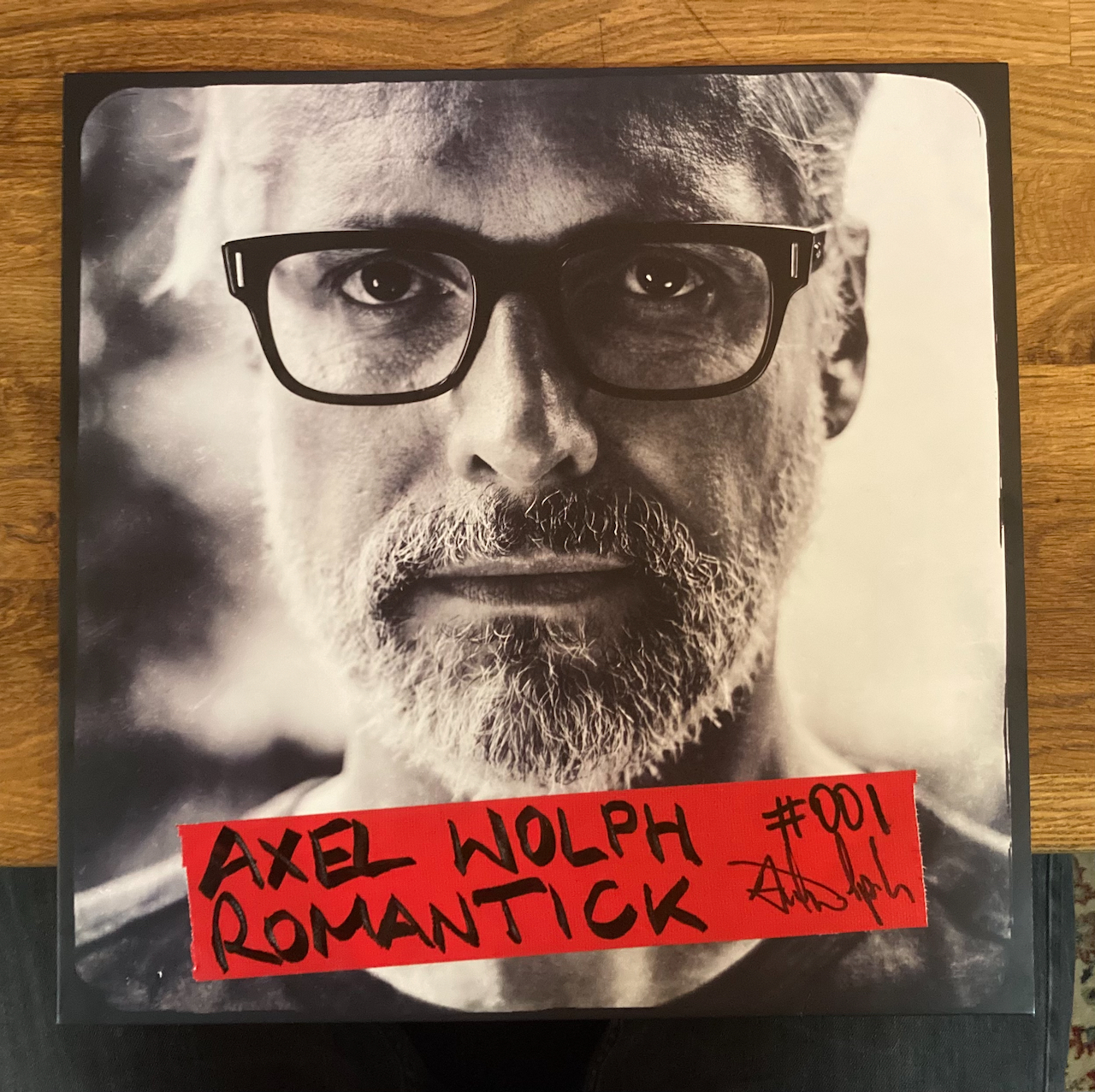
„DISZIPLIN IST DIE KUNST, SICH DIE FREIHEIT ZU NEHMEN.“
Diesen sperrigen Satz sagte vor ca. fünfzehn Jahren mein damaliger spiritueller Lehrer Alexander zu mir, am Ende einer meiner unzähligen Stunden bei ihm. Als ehemaliger Leistungssportler fühlte ich mich von diesen Worten sofort und unmittelbar in meiner Freiheit beschnitten und stimmte ihm mit den Worten „Oh ja, mir selbst die Freiheit weg zu nehmen - darin bin ich wahrlich Weltmeister!“ zu. Alexander lachte, schallend laut, wie immer, fast schon spöttisch auslachend laut. „Was hab ich jetzt wieder falsch verstanden“, fragte ich sofort in sein Gelächter hinein, leicht angewidert. „Nichts!“, sagte er, „Du hast diesen Satz genau so verstanden, wie du ihn für dich verstehen möchtest. Wie könntest du ihn noch verstehen?“ Ich überlegte und rezitierte „Disziplin ist die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen“ immer und immer wieder mehrmals laut und leise vor mich hin. Und plötzlich machte es Klick im Kopf.
Ja, Disziplin ist wahrlich die Kunst, sich die Freiheit zu nehmen, die man braucht. Und eben nicht im Sinne von sich selbst wegnehmen, sondern im Sinne von zugreifen und an sich ziehen. Anders gesagt und im Imperativ formuliert: Nimm dir die Freiheiten, die du brauchst, damit es dir gut geht! Und zwar rechtzeitig, bevor der Lärm von innen sowie von außen in dir zu laut wird. Ja, rechtzeitig dafür sorgen, dass man frei und beweglich im Geiste bleibt - rechtzeitig das tun, was einem selbst gut tut und somit im Umgang mit sich selbst und der immer lauter werdenden Welt da draußen hilft. Dies in meinem Leben zu integrieren war noch ein etwas längerer Weg, gerade auch als dreifacher Familienvater eine doch größere Herausforderung - und auch heute noch, vergesse ich immer wieder auf mich selbst zu achten. Immer wieder mache ich die bereits tausendfach erprobte und erlebte Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn man den Zeitpunkt für die eigene Freiheit verpasst.
Und genau heute in der Früh musste ich abermals an diesen Satz von Alexander von damals denken. Bloß warum? Letzten Freitag erschien mein neues, bereits siebtes Soloalbum - mein erstes Album in meiner Muttersprache mit dem schönen Titel „Romantick“. Am Freitag Abend feierte ich - obwohl ich mich schon nachmittags kränklich und unwohl fühlte - noch ein bisschen mit Athena und Freunden im Studio die Geburt meines neues Werkes. Gar nicht klug, aber schön wars. Die Rechnung für meinen Übermut bekam ich am Tag darauf in Form von extremstem Husten, Halsschmerzen und allem was dazu gehört, am Frühstücksteller präsentiert. Freud und Leid mal wieder nahe beisammen - wie so oft im Leben. Zuerst war ich unheimlich enttäuscht von mir selbst - dieses Gefühl hielt aber nicht lange an. Ich bemerkte schnell, dass mein Körper und auch mein Geist Ruhe und Stille benötigen. Schönerweise sind meine Söhne schon größer und Athena eine großartige, fürsorgliche Partnerin und somit konnte ich ruhen. Abwarten und Tee trinken, sozusagen.
Plötzlich bemerkte ich, wie schön es ist, die Zeit mal einfach wieder nur vergehen zu lassen - ohne Stress und elendslangen Todo-Listen. Ich meditierte und suchte die Stille in mir auf - ja, wach sein, ohne zu denken. Dies dauert zwar immer eine gewisse Weile, wenn sie aber eintritt ist es immer wieder ein herrliches Geschenk. Und aus dieser Stille heraus Gedanken und Emotionen zu beobachten ist auch immer wieder ein besonderes Erlebnis.
Und so viel mir auch auf, dass es ein wunderbares Gefühl ist, ein neues Werk in den Händen zu halten. Ja, ich weiß, dass ich da ziemlich „old school“ bin, aber so wurde ich halt mal geprägt und im Unterschied zu manch anderer Prägung in meiner Kindheit, finde ich diese absolut lebenswert und schön. Stundenlang bin ich als Kind und Jugendlicher mit unzähligen CDs und Schallplatten in den Händen am Boden vor irgendwelchen Lautsprechern gesessen und habe Musik in mich aufgesaugt. Ja, Musik - die wohl schönste Art, sich selbst die Freiheit zu nehmen, egal ob als Musiker oder als Zuhörer. Und genau das faszinierte mich schon damals und hielt eigentlich bis heute an. Eigentlich sage ich deshalb, weil es einfach viel zu selten im Alltag passiert. Meistens hört man schnellschnell mal am Smartphone auf irgendeinem Streaming-Portal in einen Song rein und zappt sich schnell weiter - so wie im TV Programm abends auf der Couch. Und wenn ich meine Söhne oder die jüngeren Generationen so beobachte, dann wird mir alleine davon schon schlecht. Gleichzeitig ertappe ich mich selbst, wie ich völlig sinnlos durch Social Media Plattformen scrolle und dabei völlig unbewusst meine Sinne und manchmal auch meinen Verstand beinahe verliere. Permanenter Müll im Zickzacktempo. Genau SO wollte ich NIEMALS leben. Ich bin und bleibe ein von Grund auf wildromantischer Mensch. Ich liebe das Langsame. Ich liebe es Emotionen zu durchleben, nicht nur anzutriggern.
Als ich mit sanften 14 Jahren, damals noch völlig dem Tennis verfallen, begann, Songs zu schreiben, lag die sogenannte Aufmerksamkeitsspanne für Popsongs bei drei Minuten - letztens musste ich erfahren, dass die Tendenz heutzutage in Richtung 15 Sekunden geht. Tiktok und der ganze Müll machen dies möglich. Unglaublich eigentlich. Schauderhaft, grindig - und gefährlich! Es ist eine Welt von Schlagzeilen, von Inhaltslosigkeit, Fassaden und Oberflächen geworden. In der Schule meines Dreizehnjährigen wird es nun gleichaltrigen Mädchen verboten, bauchfrei und in Jogginghosen oder minimalen Hotpants und maskenmäßiger Schminke in die Schule zu gehen. Ja, Verbote bringen seltenst Verbesserungen und die Kinder von heute werden tagtäglich stundenlang mit dieser fürchterlichen, substanzlosen Fassadenwelt gefüttert. Wir selbst arbeiten als Eltern ganz stark und intensiv mit unseren Söhnen daran, dass man nicht immer im Leben alles was da draußen passiert mitmachen muss. Klar, Gruppenzwang und Coolness-Kämpfe, aber: nein. Ich versuche als Vater und auch als Musiker und Sport- bzw. Tennisbegeisterter Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen die Begeisterung und den Mehrwert durch haptische, sprich in der Realität passierende, fühlbare Aktivitäten und Erlebnissen nahe zu bringen. Eine Stunde echtes Tennisspiel ist mit keinem Computerspiel zu ersetzen oder gar zu vergleichen. Kein fünfzehnsekündiger Video- oder Musikstream kann das Erlebnis einer Schallplatte oder einer CD ersetzen. „Es gilt die Lebenszeit zu nützen, denn sie ist rar“, sag ich jetzt schon zum dritten Mal hintereinander in meinen Podcast-Beiträgen.
Und genau in diese Kerbe schlägt meine Existenz und mein Handeln. Ja, meine Musik, meine Tonträger, mein Tennisunterricht, meine Stille-Sitzungen, mein Klavierspiel, mein Motorradfahren, mein Schreiben und Vorlesen. Ich bin zwar selbst präsent auf Instagram und Facebook, aber dies schlicht aus Vermarktungsgründen meines musikalischen Schaffens. Dass ich diese Kanäle in Wahrheit am liebsten sofort nicht mehr selbst bespielen möchte, ist eine andere Geschichte. Aber mittlerweile habe ich den Umgang damit soweit mal ganz gut im Griff und über die Jahre gelernt, was man wie in welcher Zeit erledigen kann. Dass man als Künstler tagtäglich mit Following-Zahlen, also Likes, Shares und Views konfrontiert wird, wird mir immer egaler. Wenn jemand meine Qualität daran misst, gehört er oder sie klar ersichtlich nicht zu meiner Zielgruppe.
Und so hab ich mich als an einer bakteriellen Lungenentzündung erkrankter Sportmusikant auch gestern mal wieder hingesetzt und bewusst mein „Romantick“ Album in meinen Händen gehalten und hingehört. 40 Minuten lang. Zuerst Seite A, dann die Platte wenden und dann Seite B. Danach noch „Abbey Road“ von den Beatles und „In Rainbows“ von Radiohead. Ja, dies dauert länger aber es ist und bleibt eine wundervolle Kunst, sich selbst diese Freiheit zu nehmen.
Halbgenesen werde ich heute auch wieder den Tennisplatz aufsuchen und jungen Menschen dabei helfen, Phreude an der Bewegung und dem gelben Filzball zu entwickeln und zu erleben.
Ich wünsche euch allen für heute und die kommende Woche viele langsame, phreudvolle, emotional wertvolle, ja vielleicht sogar stille Momente. Oder wie Paul McCartney einst so schön schrieb: „Let it be“, ja, lass es sein, das Sein.

DER GEFÜHLEKATALOG - ZEHN LIEDER IM SINNE MEINER ROMANTICK.
Am kommenden Freitag, den 14. Oktober 2022, ist es nun also soweit: mein erstes Album mit Songs in meiner Muttersprache erblickt das Licht der Welt. Und als Zugabe gibt es noch eine Neuauflage meiner „Muttersprache“ EP, mit „Vorhang fällt“ einem noch unveröffentlichten Song, den ich nach dem Ableben meiner Mutter in einer Reihe mit „Vorüber gehen“, „Du regnest“ und „Immer da“ geschrieben habe. Ohne dem Wunsch meiner Mutter, auch mal Songs zu schreiben, die sie auch gleich verstehen könnte, würde es wohl nun auch kein „ROMANTICK“ Album geben. Dafür danke ich ihr nachträglich sehr - auch wenn sie diese Songs nicht mehr zu hören bekommt.
Ich möchte meiner Mutter hier und jetzt auch nochmals für meine wildromantische Kindheit danken. Sie ließ mich in Baumkronen klettern und stundenlang dem Wind lauschend dort oben verharren. Sie nahm mir jegliche Angst, gab mir Geborgenheit und stillen Rückhalt - sie war immer da, ohne jemals aufdringlich zu sein oder gar im Zentrum stehen zu wollen. Sie ließ mich sein - so wie ich bin. Sie gab mir Rückendeckung - so sehr, dass ich es nicht einmal bemerkte. Dies wurde mir alles erst viel später klar - Jahre später, als ich lernen musste, dass die Gesellschaft in der wir Leben, niemals auf einen wartet. Anders gesagt: Ob man existiert oder nicht, ist einer schlicht auf Leistung, Wachstum und Kapital basierenden Gesellschaft per se völlig gleichgültig. Kinder sind oftmals generell unerwünscht oder nur Statussymbole - der Wert der Familie hat sich in unseren Breitengraden kläglichst vermindert. Leben heißt überleben und tägliches kämpfen, egal ob in der Schule oder im Berufsleben. Demnach sehr unromantisch das Ganze mittlerweile. Vom später erlernten, Buddhistischen Grundprinzip „Leben heißt leiden“ hatte ich damals noch keinen Schimmer. Meine Kindheit, ja die vielen Stunden alleine mit meiner Mutter (meine Schwester verließ die Familie als ich sieben Jahre jung war und mein Vater ging konsequent seiner Karriere als Autoverkäufer nach) war ohne Zweifel die Grundsteinlegung für meinen auch heute noch ausgeprägten Hang zur Romantik. Aber was sagt eigentlich das Lexikon zu diesem Begriff?
Im Oxford Wörterbuch steht: „Epoche des europäischen, besonders des deutschen Geisteslebens vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die in Gegensatz steht zu Aufklärung und Klassik und die geprägt ist durch die Betonung des Gefühls, die Hinwendung zum Irrationalen, Märchenhaften und Volkstümlichen und durch die Rückwendung zur Vergangenheit“. Als Merkmale werden die „Verklärung des Mittelalters, Weltflucht, Hinwendung zur Natur, Betonung subjektiver Gefühle und des Individuums, Rückzug in Fantasie- und Traumwelten, Faszination des Unheimlichen“ angeführt.
Ja, dem kann ich tatsächlich bis heute viel abgewinnen. Schon als kleiner Bub wollte ich alle Gefühle sammeln und in einer Art Gefühlskatalog anlegen. Ich hatte die naive Vision, ja den Kindheitstraum von einem Buch der Gefühle, wo alles, was man empfinden kann detailverliebt und grenzenlos ehrlich beschrieben wird. Doch schon bald musste ich erkennen, dass ich dieses Vorhaben wohl niemals in nur einem Leben vollenden könnte - zu viel empfand ich für alles und jeden und jeden Tag aufs Neue neue Gefühle - die unzähligen Facetten wuchsen zur Lawine und begruben meine Emotionssammelwerkträume.
Erst als ich mit 14 Jahren begann selber Songs zu schreiben, bemerkte ich, dass dies zumindest ein kleiner Weg in Richtung Gefühlsverarbeitung und -speicherung sein kann. Die Verbindung von Wort, Melodie, Harmonie und Interpretation erwies sich als sinnbringende Kombination und Waffe im Dickicht der Emotionen - übrigens: das Wort „Emotion“ ist ein englischer Neologismus aus „energy in motion“ - also Energie in Bewegung oder eben einfacher gesagt: Schwingung. Und wie man mittlerweile auch in der Physik weiß, ist alles Schwingung. Jedes Wort, jede Zelle, jedes Atom. Und dies wiederum bedeutet auch, dass alles Emotion ist. Alles was der Physik von Schwingungen entspricht, entspricht auch der Physik von Emotionen, siehe Resonanz, Interferenz, Verstärkung und Schwächung.
Als Kind war es wunderbar, sich all den Schwingungen hingeben zu dürfen. Nur selten bekam ich Sätze wie „Jetzt schau nicht so hin!“ oder „Jetzt nimm nicht immer alles so wörtlich!“ zu hören, und natürlich konnten diese Aufforderungen zur Stumpfsinnigkeit auch nur irgendwas an meinem Sein, Fühlen oder Handeln ändern. Ich bin ein hochsensibler Beobachter seit ich denken und fühlen kann. Meine Mutter ließ meine Hypersensibilität zu - selbst gefangen in einer in Testosteron getränkten Welt - Männerherrschaften überall. Selbstbestimmung für eine Frau ein Fremdwort, die Emanzipation noch in Babyschuhen. Meine Mum war eine stille Revoluzzerin - „niemals laut, aber immer da“, schrieb ich treffend mit einfachsten Worten im Song „Immer da“.
Je älter ich werde, desto wichtiger wird für mich diese bewusste Zurückhaltung, dieses Understatement, dieses, ja unmännliche Gehabe und diese unegozentrische Lebensart. Wo wir wieder automatisch bei der Definition von Romantik gelandet wären: Rückkehr zur Natur, Betonung subjektiver Gefühle, Rückzug in Traumwelten, etc. Ja, ich erkenne in der Selbstbetrachtung immer mehr, dass ich tatsächlich jener Mensch geworden bin, der ich schon immer war und der einst von einem deutschen Musikkritiker als „romantischer Anarchist“ bezeichnet wurde. Ja, ich verachte Hierarchien, begegne Menschen offenherzig und gleichwertig und kann der rein materiellen Welt nichts abgewinnen. Ich habe die Stille kennen und schätzen gelernt - ja, das bewusste Wachsein ohne zu denken. Im Gegensatz zur Erkenntnis von René Descartes „Cogito ergo sum“, („Ich denke, also bin ich“) widerspreche ich gerne mit „Sentire ergo sum“ - „Ich fühle also bin ich“. Und stelle auch gerne das Gegenbeispiel in den Raum: Wenn ich als Mensch nur bin, weil ich denken kann, dann wäre ich als Mensch bevor ich denken kann inexistent. Jedes Neugeborene, jeder Mensch bis zum zweiten Lebensjahr wäre demnach nicht da - jeder neue Mensch kann aber vom ersten Atemzug an fühlen. Die Emotion ist demnach der Ratio vorrangig. Eindeutig. Und immer.
Womit ich wieder bei der Musik gelandet wäre. Die Emotion, das subjektive Empfinden steht auch hier im Zentrum meiner Wahrnehmung. Ich setze mich nie hin, um bewusst oder gewollt einen Song oder Musik zu schreiben. Alles passiert, je nach dem, wie mir gerade ist. Das Denken hilft mir, die Gefühle zu ordnen und zu verstehen. Das Denken hilft mir im Handeln, das Fühlen ist mein Sein. Demnach sind alle meine Songs (ich hab sicher schon mehr als 300 Songs geschrieben) mit autobiographischen Zügen versehen. Und ich kann auch zu jedem Song meines „Romantick“ Albums genau sagen, was das Gefühl, die Situation und demnach auch die Gedanken dazu waren oder sind:
„Anders als richtig“: Ein Song als Dialog mit mir selbst - mit meiner besseren Seite - dem guten Wolph in mir. „Es wär’ doch zu schön mit dir“, sing ich. Eine Selbstreflektion auf den allmenschlichen inneren Kampf mit sich selbst. Ein Lied für die Vorstellung, ja der Traumwelt eines Lebens ohne dem Troublemaker, ja dem schmerzbringenden Ängstlichen und Zweifler in mir. „Es wär’ doch zu einfach mit dir“, „Es wär’ doch nicht nur anders als richtig“, hab ich für mich passend zur Stimmung und zu den Gefühlen geschrieben. An der Oberfläche liest sich der Text zum Song wie ein Liebeslied - und genau dies, machte den Song als Ganzes für mich gut und spannend. Ich liebe es, wenn Texte mehrere Ebenen besitzen - ich liebe es, wenn Musik weiter in die Tiefe geht und dennoch eingängig und einfach bleibt.
„Lass mich“ ist ein Song, den ich vor elf Jahren geschrieben habe. In einer schwierigen Zeit für mich und meine Frau Athena. Ein Song, der wie so viele in weniger als einer Stunde fertig geschrieben und getextet war. Ein Text voller Trennungsangst und offenkundig gestandener Liebe kombiniert mit kalifornischem Westcoast Sound - à la ich bin unterwegs ins Nirgendwo, aber ich bin unterwegs und somit am Leben. Und so lange ich lieben kann, lebe ich. Ein dunkler Moment kombiniert mit positiven musikalischen Vibes. Ja, sowas mag ich.
„Die Bäume“ ist ebenfalls ein Song, den ich schon vor Jahren ganz spontan und unüberlegt in meiner Muttersprache geschrieben habe. Ich befand mich in einer gewissen Aufbruchsstimmung, wollte raus in die Welt, um mich selbst besser kennen zu lernen und zu finden. Thematisch demnach nahe dran an „Lass mich“ aber mit ganz anderer Musik versehen - introvertierter, in sich ruhender, zurückhaltender.
„Amen“ wiederum ist einer jener Songs, die manchmal quasi zwischen Tür und Angel passieren. Ein simples Gitarrenriff, eine Stimmung, ein Tempo - alles kombiniert ergibt eine Mood, wie man so schön neudeutsch sagt. Ein Text ohne viel Überlegen einfach hin gerotzt, gepaart mit einer gewissen Scheißdrauf-Stimmung in mir. „Keiner trägt die Last in meinen Sandalen, keiner wütet in mir wie meine Vandalen…“ singe ich zu Beginn - und diese beiden Zeilen geben schon klar und deutlich die Richtung vor. Die Opening Lines sind mir immer sehr wichtig beim Texten - darüber sinniere ich wohl am längsten bei jedem Songtext. Und ich mags auch Worte zu entfremden - wie hier zum Beispiel „Amen“. Natürlich verwende ich es dieses Wort hier nicht im Christlichen Sinn, sondern vielmehr im Sinne von „scheiß drauf, weitergehts“. Das Schreiben an sich ist für mich sehr oft wie ein Spiel mit Worten. Gerade in meiner Muttersprache jongliere ich gerne mit Wortbedeutungen - fühle mich künstlerisch frei und kann tun und lassen was ich will. Ich schreibe auch gerne bewusst Wörter falsch oder umgehe die Rechtschreibung. Gesetze dienen der Orientierung, aber sie können mich in meinem Schaffen niemals einengen: „Amen!“
Mit „Lieber Februar“ ist mir eines meiner schönsten Liebeslieder gelungen, möchte ich bescheiden feststellen. Ein Liebeslied an jenes Monat, welches mir Jahr für Jahr Probleme schafft. Immer nach meinem Geburtstag am 20. Jänner gehe ich psychisch wie auch physisch energetisch in die Knie. Und vor einem Jahr saß ich dann Anfang Februar plötzlich im Studio und schrieb diesen Song. „Hörst du nicht, wie die Welt zerbricht…“ singe ich im Refrain - damals natürlich noch unwissend, dass wir ein Jahr später mit doppelten Lebenskosten und einem riesigen Krieg und unzähligen Bedrohungen zu kämpfen haben werden. Am Schluss schaffe ich den textlichen Twist - die für mich sehr wichtige Wendung in der Aussage: „Die Welt zerbricht - nicht.“ Hoffnung lässt uns weiterleben und deshalb gehört sie auch geschürt.
Absolut schön finde ich, dass es mein Album auch als Digipack CD und hochwertigem 180g Vinyl geben wird. So wie früher mit dem Booklet sitzen und bewusst Musik hören und lesen. Auch dies war fixer Bestandteil meiner Kindheit und Jugend. Ich weiß noch genau wie ich mich fühlte, als ich zum ersten Mal „Imagine“ von John Lennon hörte, beim Plattenspieler meines Vaters am Boden sitzend. Tränen in den Augen - unverstandene Tränen, denn sie waren neu. Die Musik bewegte mich zutiefst und begeisterte mich - im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ein paar Jahre später dann „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Was für eine Kraft und Energie! Wow, bis heute.
Letzte Woche beobachtete ich Nielsi, meinen dritten, zehnjährigen Sohn dabei, wie er sich ganz bewusst und in sich ruhend alle 15 Songs von der „Romantick“ & „Muttersprache Deluxe“ Digipack CD auf seiner kleinen Hifi-Anlage anhörte. Die Beine überkreuzt in Denkerpose, still mitsingend und Wort für Wort lesend. Am Ende stand er auf, ging zu mir rüber in die Küche und umarmte mich still und lange. Ein für mich unbeschreiblich schöner und unvergesslicher Moment. Ich fragte noch naiv „Und, hats dir gefallen?“. Er antwortete wie ein alter, weiser Mann mit Blick in meine Augen: „Ja, Papa, es hat mir sehr gefallen.“ Die Kraft der schlichten Worte hat er schon in jungen Jahren begriffen.
Ihm ist auch der erste Song auf der B Seite der Schallplatte gewitmet. „So schön“ habe ich geschrieben, als er mal einen ganzen Vormittag kränklich bei mir im Studio verbrachte. Seine Ausstrahlung, seine Blicke und Worte ließen mich dieses Lied schreiben. Ein Text voller Dankbarkeit und Liebe. Für den Moment und sein Sein. Dankbarkeit dafür, dass das Leben auch solche Momente und Lebewesen, ja Begegnungen mit sich bringen kann. Große Gefühle simple für die Ewigkeit verpackt. Ach ja: Als ich den Song hatte wollte ich ihn gleich wieder in die Schublade geben, weil er mich harmonisch zu sehr an „Creep“ von Radiohead erinnerte - ebenfalls ein schöner Song meiner Jugend. Aber dann dachte ich „Scheiß drauf! Ist so, bleibt so, ist gut so.“ Und das Songwriting Rad hat seit den Beatles sowieso niemand mehr neu erfunden. Alles wiederholt sich - und „So schön“ ist in voller Gänze ein Song von mir.
Dass das Leben ein sich stets wiederholender Kreislauf ist, ist Thema von „Wie es war“. Abermals ein tief gehender Text kombiniert mit zeitlosem, positivem Westcoast Sound. Ich mag auch Songs, die man mehrmals entdecken und lieben lernen kann. Dies ist genau so einer - auch für mich als Urheber wächst der Song mit jedem Anhören weiter. Ich entdecke neue Nuancen im Spiel der Musiker, neue Textpassagen, die mich berühren: „Nichts sag ich zu dir und du schweigst zurück. Jeder kennt doch jeden, niemals so richtig gut.“ hats mir letztens erst angetan. Texten als Spiel mit Worten. Immer wieder schön, wenn man damit ins Tor der Gefühle trifft.
Wie dunkel das Sein kann sein weiß wohl jeder/jede, der oder die noch nicht völlig im Alltagstrott verstumpft ist. Und klarerweise hab auch ich dunkle Tage. Und genau an so einem scheiß Tag hab ich „Einer dieser Tage“ geschrieben. Rauchig, reduziert, rudimentär instrumentiert und wie eine alte Neil Young Platte klingend zu Beginn. Aber irgendwie wollte ich nicht in der Mood der ersten Strophe bleiben. Ich wollte mir selbst den Kopf aus der lyrischen Schlinge ziehen. Ich wollte, dass der Song in die Zuversicht kippt und wie eine Morgensonne durch den Nebel aufgeht, um schließlich wieder hell zu leuchten. „Ein neuer Tag muss her!“ kam bei dieser Wendung am Schluss dann raus. Eine Transformation ins Positive - das Leben ist und bleibt eine tägliche Geschichte. Heute so, morgen so. Übermorgen so. Und ein neuer Tag bleibt wohl das zeitlebens größte Geschenk. Dies dachte ich mir auch ganz klar, als ich meine Mutter zum letzten Mal lebendig sah. Sie hätte auch noch gerne einige neue Tage erleben dürfen. Eine Morgensonne durch den Nebel. Ein wildes Vogelgezwitscher oder eine sanfte Brise in einer Ahornbaumkrone.
Der vorletzte Song „Alleins sein“ entstand über mehrere Wochen. Die Harmonien und die musikalische Stimmung war mir schnell klar und schrieb sich wie von alleine. Textlich drehte ich mich ein wenig im Kreis, bis ich erkannte, dass es genau darum geht: „So wie die Welt sich dreht und Zeit von alleine vergeht, so wie der Wind sich dreht, so selbstverständlich, so unvergänglich bist du.“ Stand dann schließlich und endlich mit Kugelschreiber auf Papier geschrieben. Eine Odé an mich und mein Leben, ja mein Dasein im Hier und Jetzt.
Und als ich viele Songs geschrieben hatte, fehlte mir genau noch eine emotionale Stimmung, die ich irgendwie noch umkreisen wollte wie ein Adler seine Beute. Eines nachts schlug ich zu und schrieb „Nachts“. Aus dieser Stille, unabsichtlich geweckt von meinen Söhnen im nächtlichen Ehebett, entstand diese, einzige Klavier-Ballade am Album. Textlich voller Dankbarkeit und Liebe an Athena - für unseren bereits zwanzigjährigen Weg zusammen. „Wenn nachts die Zeit für eine Weile stillsteht und Stille den Tag verweht, schreib ich dir diese Zeilen, auf Papier können Worte verweilen…“. „Und wir, sind immer noch hier, Jahr für Jahr näher an dir. Ja, wir sind immer noch hier und wir bleiben.“
Ich wünsche euch allen viel Vergnügen mit meinem ersten Album in meiner Muttersprache, meinem Hang zur Romantick gewidmet. Ich wünsche euch Zeit damit. Es gilt die Zeit zu nützen, denn sie ist rar oder anders gesagt „Das Leben kann so schnell an dir vorübergehen“.
IHR LETZTER WUNSCH.
Ich glaube, es war an einem Freitag. Oder Donnerstag. Egal. Jedenfalls war es unmittelbar nach meiner mündlichen Matura Prüfung in Deutsch. Mit Tränen in den Augen hinter ihren aschenbecherdicken Brillengläsern sagte meine Deutschprofessorin, Frau Magister Pichler, coram publico vor der versammelten Prüfungskommission folgende Worte zu mir: „Lieber Axel, danke. Ich habe heut noch einen ganz großen Wunsch an dich: bitte schreib weiter. Bitte schreib, schreib, schreib und lass es mich wissen!“ Sogar jetzt noch, 24 Jahre danach, berührt mich diese, mir damals insgeheim sehr peinliche Situation immens. Ich war wie versteinert und konnte kaum auf ihre Worte und Emotionen reagieren. Ich befürchte, ich grinste sogar leicht ob der Skurrilität des Momentes. Mittlerweile musste ich erfahren, dass sie schon vor einigen Jahren ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hat. Ich hab sie tatsächlich nie mehr wieder in meinem Leben nach der Matura gesehen oder gar in der Schule besucht. Heute tut mir dies unbeschreiblich leid - immer wieder kommt mir diese Situation seither in den Sinn. Und immer wieder frage ich mich, wie ich bloß so ein eingebildeter, abgehobener Scheißkerl sein konnte. Sie liebte meine Texte, förderte und motivierte mich. Sie machte mir Mut zu meinen Texten und Worten zu stehen. Sie war traurig, mich nicht mehr als Schüler zu haben und hatte den beachtlichen Mut, dies vor all den anderen Lehrern zu zeigen. Sie laß fast nach jeder Schularbeit meine Texte vor der Klasse vor - dass dies als Teenager oder sagen wir junger Erwachsener, wahrlich äußerst uncool war, muss ich niemandem erklären, war ihr aber völlig egal. Vor den KlassenkameradInnen cool zu wirken war mir offenbar immer wichtiger als die Substanz und Anerkennung, die sie mir schenkte.
Beim heutigen, zweistündigen Waldmarsch über Stock und Stein, durch Schlamm und nasse Farne, warf ich immer wieder mal einen Blick zurück auf mein Leben seit der Schule. 24 Jahre in der Retrospektive. Und immer wieder kam mir diese Situation in den Sinn. Und die ganzen Emotionen dazu - als wäre es gestern gewesen. Ich höre ihre Worte aus weiter Ferne. Je näher sie kommen desto lauter werden sie. Ihr wunschvoller Appell ist als Schrei in meinem Gedächtnis verankert geblieben. Gefühlte Milliarden von Liter Bier und ungesundem Lebensstil später, besteht die Syntax zu diesem Erlebnis immer noch. Faszinierend, wenn es nicht so traurig wäre.
Nach der dritten Begegnung mit einem Feuersalamander am nassen Waldboden bemerkte ich, dass ich ihrem Wunsch sogar noch eine Weile nach dem Schulfinale nachkam. Ich zog zu meiner damaligen Freundin nach Wien, begann Theater, Politik und Publizistik zu studieren und schrieb ein Theaterstück mit dem Titel: „Schattengespräch - Der Mann, der von der Treppe fiel“. Es handelte von einem zirka Fünzigjährigen, der in seiner dunklen Kammer über sein Leben sinnierte - ein düsterer Monolog in Versen. Ich weiß sogar noch die ersten Worte: „Es begann an einem kahlen Tag, der Himmel voller Trübheitsschlag. Das Ich wund in der Wonne liegend, still und ruhig, wohl angeschmiegt…“ Ich hatte schon zweihundert Seiten, soweit ich mich erinnern kann - dass Stück ist auf meinem ersten Apple Computer aber mittlerweile leider wohl auch verstorben. Auch traurig, sehr. Der Typ jedenfalls wurde auf der Bühne von seinem Schatten, dargestellt von einem zweiten Schauspieler, der sämtliche Bewegungen des Protagonisten synchron mitmachte und schließlich mit ihm in den Dialog trat, begleitet. Ein zwielichtiges Zwiegespräch zwischen Mensch und dunkler Seele. Am Schluss, als der Weißhaarige wieder zu Trost, Hoffnung und auch Freude zurück fand, stieß der Schatten seinen Mann von einer Treppe, die ganz kahl und rudimentär schon das ganze Stück lang noch unbedeutsam auf der Bühne stand.
Ich hatte das Stück fertig im Kopf, doch dann kam plötzlich vieles ganz anders - wie so oft in dieser tausendfachen Aneinanderreihung von täglichen Geschichten namens Leben. Ich bekam ein Jobangebot, als zwanzigjähriger Kreativkopf und Multimedia Autodidakt bei einer Tochterfirma der damals größten Webagentur Österreichs. Der Reiz nach Selbstverdientem und das Verlangen nach Unabhängigkeit vom Geldbörserl meines geschäftstüchtigen, karrierebesessenen, Bayrische Autos verkaufenden Vaters ließ mich exmatrikulieren und blauäugig fortan ins Leben stürzen. Geld macht erwachsen, dachte ich wohl. Die sogenannte New Economy boomte und ich schwamm zweieinhalb Jahre lang gutverdienend mit dieser mächtigen Wirtschaftswelle mit. Ich schrieb keine Theaterstücke oder Bücher mehr, auch selten nur mehr Songs - stattdessen schrieb ich vor Innovation triefende, abgehobene Konzepte zum Thema Online Communities und präsentierte die bei großen Musiksendern oder Automobilherstellern. Ich tauschte meine zerrissenen Jeans für Sakkos und hippe Sneakers. Ich war ein Bobo der ersten Stunde. Ein Hipster in der Großstadt mit erstem eigenen BMW - beim Vater stolzbrüstig bestellt mit eigenem Geld. Ich verließ meine bereits langjährige, treue, großartige Freundin für eine blonde, heißblütige Usability Spezialistin und verlor den Bodenkontakt. Viel Alkohol, viel Arbeit und Drogen gepaart mit einem guten Gehalt - dies war mein Untergangscocktail. Denn plötzlich platzte diese dünnhäutige Wir-erfinden-die-Welt-neu-Blase, die ganze Branche ging in den Konkurs und ich fand mich alleine in meiner Wohnung und am Arbeitsamt für junge Arbeitslose wieder. „Unvermittelbar!" hieß es, weil Bildungsstatus Maturant, Studienabbrecher und den Job, den ich hatte, gab es im Arbeitsregister noch gar nicht. Vom Web Konzeptionisten und Online Community Manager zum ausgebrannten, kaputten Jungarbeitslosen. Traumhaft. Alptraumhaft.
Doch wie immer ging es irgendwie weiter. Zurück an die Universität wollte ich nicht. Chance verpasst - die Zeit war abgelaufen und zurück in den väterlichen Geldbeutel wollte ich auch nicht. Auf die Idee, das Theaterstück zu vollenden oder gar weitere zu schreiben, kam ich nicht - zu tief war der Selbstzweifel, zu groß die Wunden vom freien Fall und Bauchfleck. Aus dem eleganten Köpfler ins eigene Pool wurde vorerst mal nichts. Ich begann wieder Songs zu schreiben, lernte neue Leute kennen und begann meine selbsterlernten Multimedia Skills als Freelancer für Labels und unterschiedliche Firmen und Leute anzubieten. Nicht mehr ganz so hip, mühsam in kleinen Schritten. So lernte ich nach einigen Monaten der Selbstfindung und des Singledaseins (inklusive mehrerer fürchterlicher One Night Stands…) auch meine heutige Frau und Mutter meiner drei Söhne kennen. Ich entwarf für ihren Galerie artigen Haarsalon ein neues Corporate Design, schneiderte ihr ein Webkonzept und war vom ersten Moment an von ihr begeistert - kurz gesagt: selbständig, unabhängig, wunderschön und autoritär mit großem Herz. Dies zog mich magisch an. Aber dies ist eine andere Geschichte…
Heute beschloss ich im Wald, dass ich wieder schreiben möchte: Texte, philosophische Abhandlungen zu Gedanken, Beobachtungen und Gefühlen. Kurze Geschichten. Kurze Geschichten, die an einem Tag erzählt werden können. Keine elendslangen Romane - die fand ich immer schon mühsam - ich las früher Bücher immer bis zur Hälfte und malte mir dann mein eigenes Bild. Dies hat sich auch nie geändert. Jetzt möchte ich wieder selber Bilder malen - eigene Geschichten erzählen. Die Zeit nützen, denn sie ist rar.
Nach dem Ableben meiner Mutter begann ich in meiner Muttersprache Songs zu schreiben und bemerkte dabei schon, wie nahe mir das Dichten und Schreiben in der eigenen Sprache immer noch ist. Ihr letzter Wunsch war es, einmal auch Songs zu schreiben, die sie auch gleich verstehen könnte. Leider hat sie meine deutschsprachigen Songs nicht mehr erleben dürfen. Auch zu traurig. Aber immer wenn es regnet singe ihr zuliebe meinen Song „Es regnet“. Eine große Leidenschaft beginnt wieder zu blühen. Und ich möchte Frau Professor Pichler an ihrem Grab besuchen. Ich möchte ihr danken, 24 Jahre zu spät. Ich möchte ihr für ihren mutigen Appell im stickigen Prüfungszimmer laut und deutlich danke sagen. Und ich möchte mich aufrichtig bei ihr für meinen Hochmut, meine fehlende Empathie und meine Ignoranz entschuldigen. Ich tue dies heute, hier und jetzt schon in schriftlicher Form, denn es war ihr letzter Wunsch an mich zu schreiben und dem gilt es nun endgültig zu folgen.